
In Dortmund lässt ein Chor Frauen mit Migrationsgeschichte sichtbar werden. Die Sängerinnen des Frauenchors Dortmund tragen mit ihrem Gesang Forderungen und Probleme in die Öffentlichkeit und geben den Frauen so eine Stimme.
Die Fenster des Proberaums im Kulturzentrum Dietrich-Keuning-Haus stehen offen, eine leichte Brise weht ins Zimmer, von draußen sind spielende Kinder zu hören. Tische und Stühle sind an die Wände des Proberaums geschoben. In dessen Mitte stehen 16 Frauen in einem Halbkreis und blicken an die Wand. Mit einem Projektor sind dort Noten und Text von einem türkischen Volkslied projiziert. Zeile für Zeile gehen sie das Lied durch, heute üben sie es zum ersten Mal.
Ayşe Kiliç singt in dem Chor – und das leidenschaftlich gern. Für sie haben die Proben immer eine freundschaftliche Atmosphäre, sagt sie: „Wir dürfen auch albern sein, als erwachsene Frauen. Auf der einen Seite sind die Proben natürlich diszipliniert. Auf der anderen Seite aber auch spielerisch, weil die Musik uns dazu verleitet.“ Während der Probe machen die Frauen Witze, lachen herzlich miteinander und plaudern danach noch ein bisschen. Die Übungszeit ist ein Treffen unter Freundinnen.
Lieder mit Botschaft
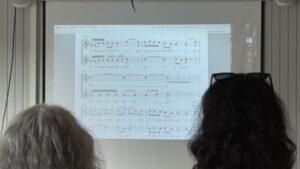
Neben gutem Gefühl und Freude transportieren die Lieder auch wichtige Botschaften, denn der Chor singt viele Protest- und Klagelieder. In deren Texten geht es um Geschlechterbilder und Selbstbestimmung, es wird Kritik an Männlichkeitsbildern und Rassismus geäußert. Themen, die den Sängerinnen am Herzen liegen, denn der Chor wird vom Migrantinnenverein Dortmund organisiert. Verein und Chor wollen mit ihrer Arbeit eine Stimme für Frauen mit Migrationsgeschichte sein.
„Wir haben das Ziel, dass sich Frauen nach draußen wagen und nicht nur ihre Stimme im Chor nutzen, sondern auch die Stimme als Revolution“, sagt Kiliç. Für sie ist Musik das perfekte Werkzeug, um Botschaften anderen Menschen nahezubringen: „Musik heißt für mich Melodie oder Klang, und das hat keine Sprache. Musik bildet eine Brücke zwischen Nationalitäten und Menschen – das ist das Schönste.“
Auftritte mit Wirkung

Mit dieser Idee tritt der Frauenchor regelmäßig öffentlich auf – zum Beispiel beim Weltflüchtlingstag 2025 in der Reinoldikirche in Dortmund. Gülizar Genç hat bei dem Auftritt mitgesungen. Sie erinnert sich gut daran, wie die Zuschauenden auf den Chorgesang reagiert haben: „Im Publikum waren viele Deutsche und auch eher christlich geprägte Menschen. Und die fanden unsere Lieder richtig schön.“ Für den nächsten Auftritt wird schon geübt. In acht Tagen treten die Sängerinnen in der Dortmunder Nordstadt auf.
Für Gülizar Genç ist der Chor zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden. Seit der ersten Probe lässt sie das Singen nicht mehr los. „Das ist wie Therapie für mich“, sagt sie und lacht. „Ganz am Anfang bin ich hier rausgekommen und habe gedacht: Mein Gott, ich fühle mich richtig glücklich und möchte weiter singen. Und unterwegs habe ich dann weitergesungen.“ Genç freut sich, dass der Chor inzwischen regelmäßig auftreten kann und dadurch eine größere Reichweite bekommt. Den in Dortmund lebenden Frauen mit Migrationsgeschichte eine Plattform zu geben, ist ihr schon lange ein großes Anliegen.
Der Migrantinnenverein Dortmund

So groß, dass sie vor 20 Jahren mit Freundinnen den Migrantinnenverein Dortmund gründete. Damals war die Gruppe auf der Suche nach einem geeigneten Ort, in dem sie sich als Frauen mit Migrationsgeschichte austauschen konnten. Doch beim Blick auf die Vereinslandschaft in Dortmund wurden sie enttäuscht. „Es waren überwiegend Männervereine, in denen zwar auch Frauen waren – meistens hatten die Männer aber das Sagen, und die Frauen haben die Arbeit geleistet. Mir war wichtig, dass wir Frauen uns über unsere Probleme aber auch über unsere Stärken austauschen können.“ Die Frauen sollten durch einen Verein Selbstbewusstsein schöpfen und sich untereinander vernetzen können – die Idee des Migrantinnenvereins war geboren. Wenn Gülizar an die Vereinsgeschichte denkt, lächelt sie: „Ich bin richtig stolz auf die Frauen. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann kommt sehr viel Positives bei rum. Dann fühlen wir uns alle richtig gut.“
Ziel der Vereinsangebote ist es bis heute, dass sich die Frauen gegenseitig unterstützen. Der Verein organisiert deshalb regelmäßige Treffen wie das internationale Frauenfrühstück. Hier können Frauen über Alltag, Stress, Gesundheit oder ihren Beruf sprechen. Die Teilnehmerinnen bringen die Themen selbst mit. Der Verein ist aber auch eine erste Anlaufstelle für Frauen mit Traumata oder Gewalterfahrungen. Von dem Verein bekommen sie bei Bedarf professionelle Hilfe vermittelt. Neben persönlichen Gesprächen diskutieren die Mitglieder viel über gesellschaftliche und politische Themen, sagt die Vereinsvorsitzende Ayşe Kalmaz. „Wir fordern, dass Frauen mit Zuwanderungsgeschichte an der Gesellschaft mehr teilhaben. Denn es gibt, bezogen auf Migration in Deutschland, ganz viele Geschichten, die nicht erzählt werden. Aber am allerwenigsten werden dann auch noch die Geschichten der Frauen erzählt.“
Frauen mit Migrationsgeschichte oft benachteiligt
Ein Grund könnte eine strukturelle Benachteiligung von Frauen mit Migrationsgeschichte in Deutschland sein. Zu dieser Erkenntnis kommt eine Studie des Europäischen Migrationsnetzwerks Deutschland, kurz EMN, aus 2023. Zeigen lässt sich diese Benachteiligung besonders gut an der Beteiligung von Frauen mit Migrationsgeschichte am Arbeitsmarkt. Laut der Studie haben nur gut 44 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen aus Drittstaaten einen Job. Zum Vergleich: Bei den Männern sind es knapp 67 Prozent. Das zentrale Problem hierfür sei laut der Studie die Unvereinbarkeit von Job und Familie.

Ein Problem, das nicht nur Frauen mit Migrationsgeschichte betrifft. Weil Frauen häufiger als Männer den Großteil der Haushalts- und Kinderbetreuungsarbeit leisten, sind sie an dieser Stelle mehrfach belastet. In der Folge müssen sich Frauen im Allgemeinen oft zwischen Familie und Job entscheiden. Bei Frauen mit Migrationsgeschichte fallen diese Probleme noch stärker ins Gewicht. Warum, ist laut dem EMN noch nicht ausreichend erforscht, allerdings lassen sich einige Vermutungen formulieren. Dem Netzwerk zufolge können allgemeine Unsicherheit, Sprachbarrieren und auch Erfahrungen mit Diskriminierung eine abschreckende Wirkung auf Frauen mit Migrationsgeschichte haben.
Kommen die Frauen durch einen Familiennachzug nach Deutschland, konnte sich der vorgereiste Ehemann häufig schon ein Netzwerk in Deutschland aufbauen und Berufserfahrung sammeln. Dieses Netzwerk fehlt den Frauen, weshalb sie schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben könnten. Viele Paare müssten sich deshalb allein aus finanziellen Gründen dazu entscheiden, Familie und Job untereinander aufzuteilen. In der Folge übernehmen häufig dann die Frauen Hausarbeit und Kinderbetreuung.
Hinzu kommt, dass Frauen aus Drittstaaten häufiger Abschlüsse in Bildungs-, Erziehungs- oder Gesundheitsberufen haben. Für die Anerkennung dieser Abschlüsse gibt es in Deutschland besonders hohe Hürden. Frauen mit Migrationsgeschichte werden bei der Jobsuche dadurch oft benachteiligt. Ob sie darüber hinaus auf dem Wohnungsmarkt oder im Gesundheitswesen Benachteiligung erfahren, lässt sich laut den Forschenden nicht genau sagen – denn hierzu fehlen aussagekräftige Daten. Erfahrungsberichte gibt es jedoch zahlreich.
Netzwerk von über 500 Frauen
Für Vereinsvorsitzende Ayşe Kalmaz ist das Diskutieren über die Probleme und Forderungen der Migrantinnen ein erster Schritt. Inzwischen hat der Migrantinnenverein ein Netzwerk von über 500 Frauen in Dortmund und Umgebung aufgebaut. Oft geht es bei den Treffen auch um Themen, die die Frauen abseits ihrer Zuwanderungsgeschichte beschäftigen. „Es geht um die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau“, sagt Kalmaz. „Uns ist wichtig, dass wir eine Plattform bieten, auf der diese Themen besprochen werden können und auf der viele Frauenorganisationen mit verschiedenen Herkünften und aus verschiedenen Generationen zusammenkommen können.“
In die Zukunft blickt sie mit gemischten Gefühlen. Rechtsextreme Parteien wie die AfD und die aufgeheizte Migrationsdebatte machen ihr Sorgen. Der Umgangston habe sich verändert, stellt Kalmaz fest: „Was wir mitbekommen, ist, dass eine Art des Sprechens salonfähiger geworden ist, die vorher nicht so üblich war. Das Allerwichtigste ist ein solidarisches Miteinander. Das versuchen wir als Verein am Leben zu erhalten. Und das wünschen wir uns auch generationenübergreifend noch mehr in dieser Gesellschaft.“
Auftritt am Dortmunder Nordmarkt

Gut eine Woche später: Auf dem Dortmunder Nordmarkt sind Tische und Stühle aufgestellt. In der Ecke steht ein „Kiosk der Solidarität“, an dem sich Menschen über Beratungsangebote für Frauen informieren können. In der Mitte des von Bäumen umgebenen Platzes ist eine kleine Bühne aufgebaut. Ein Bildschirm zeigt das Motto für die nächsten drei Tage: „Wertschätzen in Dortmund”. Von Donnerstag bis Samstag werden bei diesem mobilen Festival die Kulturen der Gastarbeiter*innen gefeiert. Und auf der Bühne steht der Frauenchor Dortmund. Er darf heute zur Eröffnung der Veranstaltung singen.
Der Ort der Veranstaltung könnte passender kaum sein: Rund um den Dortmunder Nordmarkt leben die meisten Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadt. Nach dem Auftritt freut sich Ayşe Kiliç, dass sie hier mit den anderen Frauen auftreten kann. „Generell sehe ich fröhliche Gesichter im Publikum. Eben sind auch ein paar Kinder zu mir gekommen und haben sich einfach dazugestellt. Das finde ich ganz toll, weil es zeigt, dass sie sich zugehörig und angesprochen fühlen.“ Auftritte wie dieser geben ihr Motivation, weiterzumachen, sagt Kiliç: „Es ist immer wieder aufregend, auf der Bühne zu stehen. Es ist ein tolles und schönes Gefühl.“
Beitragsbild: Simon Ewerbeck




