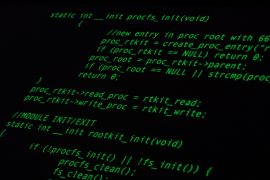Fuvahmulah, eine Insel im Süden der Malediven, entwickelt sich zu einem einzigartigen Zentrum der Hai-Forschung. Warum tummeln sich gerade hier hunderte Tigerhaie? Einblicke in das Zusammenspiel von Tourismus, Wissenschaft und Spitzenprädatoren.
Die Jäger des indischen Ozeanes kehren am Morgen zurück in den Hafen von Fuvahmulah. Sie waren die Nacht über auf der Jagd nach Thunfischen und Bonitos, einer der wichtigsten Ressourcen auf den Malediven. Es herrscht reges Treiben, wenn die Beute aus dem Indischen Ozean an Land kommt. Die Jäger sind Fischer und ihre Beute ist das Grundnahrungsmittel für die einheimische Bevölkerung. Sie tragen die Tiere an den Schwänzen in Richtung der Schlachtstelle. Dort zerlegen und verkaufen sie ihren Fang direkt an die dicht gedrängten Kund*innen.
Es riecht nach Fisch – noch ist der Geruch nicht unangenehm, aber das wird sich bei 30°C im Schatten bald ändern. Denn die Fischköpfe werden in schwarze Fässer gefüllt und in der Mittagssonne aufbewahrt. Diese Köpfe holen Tauchlehrer später ab, um damit die anderen Jäger des Ozeans anzulocken: die Tigerhaie. Hier auf Fuvahmulah herrscht seit vielen Jahrzehnten ein Zusammenspiel zwischen Menschen und Haien, dass die Insel zu einem Paradies für Wissenschaftler*innen, Taucher*innen und Hai-Liebhaber*innen macht.
Tigerhaie im Fokus der Wissenschaft
Tigerhaie sind essenzielle Spitzenprädatoren tropischer Ozeane. Sie stehen als Apex-Prädatoren an der Spitze der Nahrungskette. Das macht sie zu einer Schlüsselspezies für marine Ökosysteme, denn die Haie kontrollieren die Populationen anderer Jäger, die wiederum die Bestände ihrer Beutetiere regulieren. Fehlen die Haie, kann dies eine Kettenreaktion auslösen, die dafür sorgen kann, dass ganze Ökosysteme kollabieren. Diesen Effekt nennt die Wissenschaft trophische Kaskade. Die dramatische Folgen, die sie haben kann, entdeckt man häufig erst viel zu spät.
Die Tigerhaie von Fuvahmulah gelten als die weltweit größte erfasste Ansammlung dieser Art. Seit 2016 haben Forschende hier laut Shark ID Fuvahmulah über 280 einzelne Haie identifiziert, die durch Foto-Identifikation und moderne Lasermessmethoden dokumentiert wurden. Und die Datenbank wächst weiter. „Aktuell kommen vor allem kleinere Tiere unter 3,5 Meter hinzu. Seltener werden noch neue größere Haie identifiziert, die zum ersten Mal zu der Insel kommen“, berichtet Max Kimble, Meeresbiologe vor Ort. Tigerhaie gehören zu den Haiarten, die ihren Nachwuchs lebend zur Welt bringen. Besonders fürsorgliche Eltern sind die Haie aber nicht, denn die bis zu 80 Tigerhaibabys sind ab dem ersten Tag auf sich allein gestellt. „Wo genau die Weibchen ihren Nachwuchs zur Welt bringen, wäre für uns eine der wertvollsten Erkenntnisse, um die Haie besser zu verstehen“, erläutert Max Kimble.
„Fuvahmulah bietet durch die warmen Gewässer und das ganzjährige Nahrungsangebot optimale Bedingungen für die Tigerhaie“, erklärt Filippo Bocchi, Meeresbiologe der Tauchschule Pelagic Divers. Die Haie zeigen eine bemerkenswerte Standorttreue, was für eine Population spricht, die tiefgreifende Beziehungen zum umgebenden Ökosystem aufweist. So steht es in einer gerade publizierten Studie in Nature. Laut dieser verbringen die Weibchen im Durchschnitt rund 61 Tage am Tiger Harbour, bevor sie andere unbekannte Stationen aufsuchen, um dann wieder nach Fuvahmulah zurückzukehren. Solange sich die Haie am Tiger Harbour aufhalten, erwarten sie täglichen Besuch von Taucher*innen. An keinem anderen Tauchplatz ist es möglich nach einer maximal 2-minütigen Bootsfahrt einem Tigerhai unter häufig optimalen Bedingungen zu begegnen.
Der Tauchgang: Wissenschaft im Wetsuit
Filippo Bocchi klappt seinen Laptop zu und verlässt den Schreibtisch des kleinen Büroraums der Tauchschule. Jetzt beginnt der Teil seiner Arbeit, für den er Meeresbiologe geworden ist. Dazu braucht er Kamera, Flossen und Maske. Bocchi treiben die beeindruckenden Begegnungen mit den Haien an, so erzählt er. Vor allem aber möchte er Antworten finden auf wissenschaftliche Fragen, die helfen sollen, die Tiere besser zu verstehen. Warum nutzen die Tigerhaie diese Gewässer? Wie verhalten sich die Haie untereinander und wie funktioniert ihr soziales Gefüge?

Der Biologe begleitet eine Touristengruppe beim Tauchgang im Tiger Harbor. Es geht raus mit dem Boot, das Fass mit den Thunfischköpfen sicher verstaut. Wetsuit an, Flossen anlegen, Kamera einschalten, Maske auf, Atemregler in den Mund und „GO“. Möglichst schnell abtauchen und Riffnähe suchen, lautet die Anweisung der Tauchguides. Die Konzentration und Anspannung bei den meisten auch sehr erfahrenen Taucher*innen ist spürbar. Treffpunkt ist auf acht Meter Tiefe in Riffnähe, denn in der offenen Wassersäule und an der Oberfläche wären die Tauchgruppe am angreifbarsten. Dann geht es zügig weiter entlang der Riffformation Richtung Hafeneinfahrt.
Die Tigerhaie haben gelernt, dass sie hier leicht Nahrung finden, die die Tauchguides gleich bereitstellen werden. So dauert es nicht lange und die ersten Tigerhaie erscheinen aus dem tiefen Blau. Nicht aggressiv, nicht hektisch, aber durchaus explorativ schwimmen sie teilweise sehr nah an die Tauchgruppe heran, die sich am Riff entlang Richtung Hafeneinfahrt bewegt. Die Haie wirken eher entspannt. Die Konzentration ist bei allen Taucher*innen auf einem Hochpunkt. Die Gruppe wird von allen Seiten von Tauchguides eingerahmt, denn aus jeder Richtung kann jederzeit ein Hai auftauchen, der von den Guides im Zweifel umgeleitet werden kann. Bei manchen Tauchgängen konnten im Tiger Harbour schon über 40 verschiedene Individuen dokumentiert werden. Heute werden es knapp 20 Tiere sein.
Filippo Bocchi taucht ein wenig abseits der Gruppe. Seine Aufgabe: möglichst viele Haie filmen, fotografieren, identifizieren und später in die Datenbank aufnehmen. Er kennt die Girls, wie er die Haie gerne nennt. Die Biolog*innen erkennen die Tiere anhand eines bei jedem Hai einzigartigen Musters am Übergang von Grau zu Weiß von Ober- und Unterseite. Dieses Muster gleichen die Forscher*innen mit Archivbildern ab.
Die Chefin des Tiger Harbour
Erreicht die Tauchgruppe nun den Futterplatz am Tiger Harbour kommen die Haie merklich näher. Alle Taucher*innen werden per Handzeichen gebeten, sich in einer Reihe auf dem sandigen Boden zu platzieren, erneut umgeben von einer Formation von Guides, die die Haie auf Abstand halten. Jetzt ist der Moment für die Thunfischköpfe gekommen. Einer der Guides schwimmt zur Futterstelle und bläst einen großen Schwall Luftblasen an die Oberfläche, um dem Boot seine Position anzuzeigen. Die Crew wirft dann an genau der Stelle einige Thunfischköpfe ab, die vom Guide zwischen Steinen am Grund versteckt werden. Die Tigerhaie versuchen mit ihren Schnauzen die Steine aus dem Weg zu schieben, um einen der Köpfe zu ergattern.

Einige Minuten später und Thunfischköpfe weniger, gehen auf einmal einige Haie deutlich auf Distanz zur Futterstelle. Die Taucher*innen schauen sich zu allen Seiten um und nur die erfahreneren sehen, was jetzt passiert. Die Chefin des Tiger Harbours betritt den Ring. Rose, eine 4,5 Meter große Tigerhaidame, die nicht nur durch ihren Größenunterscheid, sondern auch ihre vielen Kerben in der Rückenflosse und einen rostigen Langleinenhaken in ihrem linken Mundwinkel zu erkennen ist. Viele der Tigerhaie tragen solche Spuren der Fischerei mit sich herum, Zeugnisse des weltweit stark betrieben Haifangs.
Rose steht wahrscheinlich unangefochten an der Spitze der internen Rangordnung. Durch ihre Position im sozialen Gefüge der Haie ist sie es nicht unbedingt gewohnt, Platz zu machen und beiseite zu schwimmen. Es wirkt, als kenne sie das Spiel. Filippo macht die üblichen Bilder von ihr, sie holt sich einen Thunfischkopf und verschwindet wieder im tiefen Blau des indischen Ozeans.
Zurück an Bord
Nach einem Tauchgang wird auf dem Boot immer mehr geredet als davor. Alle sprechen über das Erlebte und Gesehene, was allerdings selbst bei den Biolog*innen mit einer Euphorie passiert, die an den Wandertag einer sechsten Klasse in den Freizeitpark erinnert. Die Biolog*innen sagen, dass ihre Begeisterung für die Haie zunimmt, je näher sie den Tieren kommen und je häufiger sie ihnen begegnen.
Nach dem Auftauchen werden viele der Tauchgäste fragen, wie viele Haie es denn heute waren und welche Haie heute wie agiert haben. Besonders ein Hai kam der Gruppe auf dem Rückweg von der Futterstelle zum Boot sehr nahe. „Das war Shaiha“, erklärt Filippos Kollege Max Kimble, eine knapp 3,5 Meter lange Tigerhaidame, die häufig anzutreffen ist. Kimble beschreibt sie als einen Hai, der ein bisschen „sneaky“ sei. Ein Tier, welches sich gerne von hinten nähert, was Grenzen auslotet und sehr neugierig ist. Diese Neugier und Agilität stellen allerdings bei einem Raubtier eine besondere Herausforderung für die Biolog*innen und Taucherlehrer dar. Dennoch sprechen die Wissenschaftler*innen an Bord über die Haie, als sprächen sie über Arbeitskolleg*innen oder Freund*innen.
Die Rolle des Ökotourismus
Nicht nur die Biolog*innen kehren mit einer tiefen inneren Zufriedenheit in den Hafen zurück, auch die Tauchtourist*innen sind merklich beeindruckt. Kein Wunder also, dass Fuvahmulah als Hai-Destination boomt und stetig bekannter wird. 14 Tauchschulen sind mittlerweile auf der Insel aktiv. Der wirtschaftliche Einfluss ist enorm: Jährlich bringt die Industrie mehr als 10 Millionen US-Dollar ein, was Fuvahmulah zu einem der größten Zentren für Hai-Tourismus weltweit macht.
Allerdings gibt es auch Herausforderungen. „Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und den Tauchschulen, die die Biologen finanzieren, ist essenziell“, betont Max Kimble. „Es geht darum, sowohl die wissenschaftliche Integrität zu wahren als auch die Interessen der lokalen Gemeinschaft und der Touristen zu berücksichtigen.“ Die Zusammenarbeit hat es ermöglicht, zahlreiche Daten über die Tigerhaie zu sammeln, die ansonsten schwer zugänglich gewesen wären. Für die Tauchschulen sei es zum einen ein schöner Service, die Kundschaft von Meeresbiolog*innen begleiten zu lassen und somit einen tieferen Einblick in die Biologie der Haie zu bekommen. Zum anderen haben auch die Tauchanbieter ein Interesse an der Erforschung und dem Schutz der Haie, die schließlich ihr Kapital darstellen.
Die Wissenschaft hinter der Faszination
Besonders spannend ist die Frage nach den sozialen Interaktionen der Tigerhaie. Luca Asshauer, Masterstudentin der Universität Bremen, untersucht, ob diese Tiere bevorzugte Partner*innen haben oder ob ihre Zusammenkünfte rein zufällig sind. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die größten Weibchen eine klare Hierarchie etablieren und den Ton angeben. Jungtiere halten sich meist in sicherem Abstand auf, bis die größeren Haie sich entfernen.
Ein anderes Forschungsthema ist beispielsweise die Heilungsfähigkeit der Haie. Tigerhaie zeigen eine erstaunliche Regenerationsfähigkeit, etwa nach Verletzungen durch intra- oder interspezifische Konflikte. „Wir können die Heilung durch die Beobachtung einzelner Haie über Jahre hinweg dokumentieren“, erklärt Max Kimble. Solche Studien helfen, die gesundheitlichen und ökologischen Bedingungen der Population besser zu verstehen. Welche Frage er den Haien gerne stellen würde, wenn er sich mit einem unterhalten könnte? Kimble schmunzelt: „Rose, was ist deine Tagesroutine? Die Zeit, die wir mit den Tieren im Wasser verbringen können, ist auf nicht viel mehr als eine Stunde limitiert, sodass es uns nach wie vor schwerfällt, ein tiefgreifendes Verständnis von der Lebensrealität der Haie zu bekommen.“
Ein Blick in die Zukunft
Fuvahmulah bleibt ein Paradebeispiel dafür, wie Tourismus und Wissenschaft Hand in Hand arbeiten können. Doch es gibt auch Risiken: Ohne klare Richtlinien könnte der wachsende Tourismus das empfindliche Ökosystem belasten. Expert*innen empfehlen daher strengere Regeln für das Tauchen und die Fütterung, um das langfristige Gleichgewicht zu sichern. Es wird wie so oft auch hier die Herausforderung darin bestehen, ökologische und ökonomische Interessen in Einklang zu bringen.












Fotos: Maximilian Baum