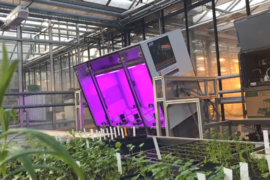Sie haben nicht den größten Einfluss, aber können an verschiedenen Stellen den entscheidenden Impuls setzen – Kleinparteien. Die Arbeit in diesen Parteien erfordert oft einen großen Aufwand, aber die Belohnung dafür fehlt.
„(…) deswegen fordern wir einen Prunkbau, der Dortmund endlich aus der Mittelmäßigkeit hebt. Ein Kolosseum ist nicht nur günstiger, sondern auch klimafreundlicher als der jetzt geplante Neubau des Schauspielhauses.“ So ertönt es in einer Sitzung des Dortmunder Stadtrats. Was hier satirisch von der Kleinpartei „Die Partei“ auf die Schippe genommen wird, ist ein typisches Problem der Politik – irgendwo fehlt das Geld dafür, ein Gebäude zu retten, das kurz vor dem Zerfall steht. Was aber die Lokalpolitik von den Sitzungen in den Länderparlamenten oder dem Bundestag unterscheidet, ist genau das, was hier den Stadtratsmitgliedern und den Zuschauer*innen auf der Empore teilweise ein Lächeln ins Gesicht zaubert, aber auch in Teilen zu Augenrollen führt. Die Präsenz von Kleinparteien.
In Stadträten in ganz Deutschland sitzen Parteien, von denen man ansonsten eigentlich nur während des Bundestagswahlkampfs etwas sieht und hört. Dann hängen sie für ein paar Wochen Plakate auf oder tauchen im Wahl-O-Mat auf, bevor sie wieder unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde verschwinden. Diese Grenze gibt es in vielen Kommunen jedoch nicht. Was macht eigentlich eine Partei, die nur einen einzelnen Sitz in einem Stadtrat mit fast einhundert Sitzen, wie dem in Dortmund, hat?
Die Arbeit unter der Fünf-Prozent-Hürde
Die Partei Volt ist wahrscheinlich die bekannteste Partei unter der bundesweiten Fünf-Prozent-Hürde – wenn man die beiden Bundestagsausscheider FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) außen vor lässt. Nach ihrem großen Erfolg bei der Europawahl 2024 mit 2,4 Prozent der Stimmen in Deutschland war die Partei für kurze Zeit in aller Munde. Doch dann kam die Bundestagswahl und nach einem gescheiterten Wahlkampf war Volt wieder wie vom Erdboden verschluckt.
Im Dortmunder Stadtrat ist Volt Teil der neusten Fraktion „Volt und Vielfalt“ und mit zwei von drei Ratsmitgliedern in der Fraktion vertreten. Ähnlich sieht es bei der Tierschutzpartei aus. Sie hat einen Sitz im Dortmunder Stadtrat und ist Teil einer Fraktion mit der Linkspartei. Wie sieht der Tagesablauf für die Mitglieder in so einer kleinen Stadtratsfraktion aus?
„Mails beantworten, Termine planen, Themen recherchieren und Anträge vorformulieren“, beschreibt Hansjörg Gebel, der Fraktionsgeschäftsführende von „Volt und Vielfalt“ und Volt-Mitglied seine tägliche Arbeit. „Ich beschäftige mich sowohl mit Administration als auch mit Fachpolitik.“ Er ist der einzige Vollzeitangestellte bei seiner Fraktion – für mehr reicht das Budget, das eine kleine Fraktion bekommt, nicht.
Kleine Büros abseits vom Hauptgeschehen
Eigentlich haben die Fraktionen Büros im Rathaus am Friedensplatz. Nicht aber Volt und Vielfalt, denn als sich die Fraktion während der laufenden Ratsperiode gründete, waren schon alle Räumlichkeiten vergeben. Deswegen sitzt die Fraktion momentan im Hinterhof einer Seitenstraße, rund zehn Minuten Laufweg vom Rathaus entfernt. Dort, in einem spärlich eingerichteten Büro, stapeln sich vertrauliche Dokumente und Aktenordner. In der deutschen Politik wird noch auf Papier gesetzt. Zu diesen Dokumenten kommen jeden Mittag weitere dazu, denn dann bringt die Post alle Neuigkeiten zu dem, was sich in der Dortmunder Politik tut.
Hinzu kommt ganz viel Koordinationsarbeit, denn alle Informationen müssen zu den sogenannten „sachkundigen Bürger*innen“ weitergeleitet werden. Das sind Personen, die die verschiedenen Ausschüsse des Stadtrats mit ihrer Expertise beraten. „In den Ausschüssen spielt die Musik. In den Ratssitzungen ist das eher Show“, fasst es der Co-Fraktionsvorsitzende Christian Gebel (Volt) zusammen, der übrigens nicht mit seinem Mitarbeiter Hansjörg Gebel verwandt ist. Für die kleinen Fraktionen sind die sachkundigen Bürger*innen quasi die Vertretung in den einzelnen Ausschüssen, weil Volt mit drei Ratsmitgliedern nicht alle 14 Ausschüsse besuchen kann. Stimmberechtigt sind sie allerdings nur in den Ausschüssen, bei Ratssitzungen nicht.
Jede Woche treffen sich Fraktionsführung, Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürger*innen zu einer Fraktionssitzung. Dort tragen sie alle Ergebnisse aus den Ausschüssen zusammen und entscheiden, wie sie am Ende abstimmen möchten. Für die sachkundigen Bürger*innen umfasst der Aufwand normalerweise die wöchentliche Sitzung des Ausschusses, dem sie beisitzen und die Vor- und Nachbereitung dieser Sitzung. Dafür bekommen sie ein nach Gesetz festgelegtes Sitzungsgeld. Es liegt momentan in Nordrhein-Westfalen bei 71,40 Euro. Für das Geld scheint das also keine*r zu machen.
Doppelte Verantwortung

Für die Ratsmitglieder ist der Wochenaufwand um einiges größer. Christian Gebel von Volt zum Beispiel braucht in einer normalen Woche mehr als 20 Stunden, um sein Arbeitspensum zu absolvieren. Für Michael Badura von der Tierschutzpartei sind es ungefähr 30 Stunden. Das Geld, das von der Stadt für diese Arbeit als Aufwandsentschädigung ausgezahlt wird, reicht nicht, um davon zu leben. Für die meisten Ratsmitglieder ist das eine monatliche Pauschale von 514,10 Euro zuzüglich 21,20 Euro Sitzungsgeld. Fraktionsvorsitzende erhalten mehr. Dieses Geld muss versteuert werden.
Deswegen üben Ratsmitglieder dazu einen weiteren Job aus oder opfern Stunden bei ihrem regulären Job, den sie meistens während ihrer Zeit als Ratsmitglied weiterführen, um ihrem Ehrenamt als Ratsmitglied nachzukommen. „Es kann aber auch nicht das Ziel sein, davon zu leben. Wir müssen erleben, wie es da draußen funktioniert“, findet Gebel. Er verweist aber auch darauf, dass einige Ratsmitglieder in Dortmund finanzielle Verluste in Kauf nehmen, um in der Politik mitwirken zu können.
Die führenden Lokalpolitiker*innen nehmen in unregelmäßigen Abständen an den Stadtratssitzungen teil. Diese bestehen aus zwei Phasen, einer öffentlichen Sitzung, bei der jede*r zuschauen kann (dieser Teil wird im Fall der Stadt Dortmund im Internet live gestreamt) und einem geschlossenen Teil, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Im öffentlichen Teil werden alle Themen besprochen, die die Stadt beeinflussen. Sei es der Neubau eines Schauspielhauses, die Schließung eines öffentlichen Schwimmbads oder die Schließung einer Straße für den Busverkehr. Im nicht öffentlichen Teil werden alle Themen behandelt, die zum Beispiel die Sicherheit einzelner Bürger*innen gefährden könnten oder starke wirtschaftliche Effekte haben.
Manchmal ist ein Vorschlag erfolgreich
Nachdem Fraktionsführung, Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürger*innen alles in den Fraktionssitzungen besprochen haben, ist es meist Zeit, bei einer Ratssitzung abzustimmen. Das ist vor allem für die kleinen Parteien und Fraktionen ein diplomatischer Drahtseilakt. „Hier darf man kein Ego haben“, beschreibt Michael Badura von der Tierschutzpartei das Arbeiten in einer kleinen Fraktion. Man dürfe auch nicht zu betroffen sein, wenn ein eigener Plan nicht durchkomme – das passiere öfter, als dass man etwas durchgesetzt bekomme.
Badura ist zusammen mit fünf Politiker*innen der Linkspartei Teil der Fraktion „DIE LINKE+“ im Dortmunder Stadtrat. Es sei schwer, allein mit so einer Minderheit Politik zu machen. Aber die wechselnden Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat – es gibt keine feste Koalition – ermöglichen es, durch Kompromisse und Verhandlungen zusammen mit anderen Fraktionen Ziele durchzusetzen. Badura ist zum Beispiel stolz auf den „No Mow May“, also den mähfreien Mai auf städtischen Grundflächen. Solche Ideen werden dann anderen Fraktionen vorgeschlagen und dann wird darüber verhandelt.
Persönliche Beziehungen knüpfen
Für Hansjörg Gebel ist das ein Mitgrund, warum die Fraktionsgeschäftsführungen der demokratischen Parteien im Dortmunder Stadtrat eine gute Beziehung zueinander führen – man weiß nie, wann man die Stimmen des anderen braucht. Das ist ein wichtiger Pfeil im Köcher der Kleinparteien, denn auch die großen Fraktionen brauchen manchmal die Stimmen der kleinen – und genau dann kann man etwas im eigenen Interesse durchbringen.

Abseits vom Getümmel und den Diskussionen im Stadtrat haben die Kleinparteien auch einiges zu tun. Ein wichtiges Ziel ist zum Beispiel das Anwerben neuer Mitglieder. Sowohl Volt als auch die Tierschutzpartei setzen hier auf ähnliche Mittel. Sie organisieren in regelmäßigen Abständen Treffen, digital oder persönlich in einem Café, bei denen sie sich mit bestehenden Mitgliedern austauschen und Interessierten die Chance geben, einander kennenzulernen.
Für diese Parteien, denen die finanziellen Mittel fehlen, eigene Werbekampagnen zu fahren, ist das besonders wichtig. Parteikommunikationsexperte Professor Frank Brettschneider von der Universität Hohenburg findet, dass Kleinparteien vor allem auf Social Media Werbung für sich machen können. Dabei hält er Kommunikationsstrategien für sinnvoll, bei denen sich die Parteien auf kleinere Zielgruppen fokussieren statt auf die gesamte Bevölkerung.
Der nächste Wahlkampf kommt
In diesem Fall ist die nächste Wahl die Kommunalwahl im September. Für die Kleinparteien ist das ein riesiger Aufwand, der sehr viel Planung, Engagement, Personal und vor allem Zeit braucht. Eine Hürde für die Kleinparteien ist nicht nur das allgemein bekannte Unterschriftensammeln vor einer Wahl, um überhaupt zugelassen zu werden. Ein grundlegenderes Problem ist, dass es an Mitgliedern fehlt. Um das zu verstehen, muss man sich mit dem Wahlsystem für die Kommunalwahlen beschäftigen.
In Dortmund gibt es für die Kommunalwahlen 41 Wahlbezirke, jeder einzelne muss mit einem*einer Kandidat*in versehen werden. Das ist für kleine Parteien wie die Tierschutzpartei schwer, denn sie haben weniger als 50 Mitglieder in Dortmund. Deshalb steht fast jedes Mitglied auf dem Stimmzettel. Für Professor Brettschneider ist das ein Zeichen dafür, dass manche Kleinparteien sich um mehr aktive und engagierte Mitglieder bemühen müssen. Probleme dabei sind zum einen die geringe Aufmerksamkeit, die diese Parteien bekommen und zum anderen der fehlende Kern an Mitgliedern, den sie anders als die etablierten Parteien nicht vorweisen. Ein Beispiel für eine Partei mit einem größeren Polster ist Volt mit knapp 70 Mitgliedern.
Bei der Tierschutzpartei kann es laut Michael Badura zu einer Überraschung für manche Mitglieder kommen: „Wenn du erfolgreicher bist als erwartet, kann auf einmal einer einen Posten bekommen, der eigentlich dachte, er wäre nur dabei, um die Listenplätze zu füllen.“ Seine Hoffnung: Die Tierschutzpartei bekommt ihre vier Spitzenkandidat*innen in den Stadtrat. Dafür bräuchte sie knapp sechs Prozent der Stimmen. Aber wie organisiert eine Partei mit nicht mal 50 Mitgliedern einen Wahlkampf?
Zusammen in den Wahlkampf
Dafür bedarf es aller verfügbaren Mitglieder und Helfer*innen. Werbestände in der Innenstadt planen, Wahlplakate konzipieren und in Auftrag geben, ein Wahlprogramm aufstellen. All das sind Aufgaben, die viel Arbeit erfordern und die komplett durch freiwillige Helfer*innen getragen werden. „Wir wollen dieses Mal ungefähr 800 Wahlplakate aufhängen und sie für diese Wahl auch mit Fotos unserer Kandidaten personalisieren“, erklärt Badura.
Die Wahlkampfstrategie auf der lokalen Ebene ist dabei nur teilweise von der überregionalen Partei kontrolliert. Es gibt einige Themen, die generell feststehen – die Tierschutzpartei setzt sich zum Beispiel überall für Tierschutz ein – andere Themen werden frei den lokalen Ablegern überlassen.
Einthemenpartei oder vielseitiges Konzept?
Ein Problem: Wer den Namen Tierschutzpartei hört, denkt an eine Partei, die sich nur für den Schutz der Tiere einsetzt. Alles andere fällt hinten runter. Dabei ist der ganze Name der Partei „Partei Mensch Umwelt Tierschutz“ – es geht also nicht nur um Tiere.
Für Michael Badura ist das Vermitteln der Botschaft, dass es um mehr als die Tiere geht, eine der Herausforderungen, mit denen er in der Kommunikation nach außen oft zu tun hat. „Wir heißen ‚Partei Mensch Umwelt Tierschutz‘, aber das kommt so nicht an. Jedes Mal, wenn wir einen Werbestand haben, werden wir darauf angesprochen, dass es uns ja nur um die Tiere gehe.“
Diese Wahrnehmung als „Einthemenpartei“ kann schwierig sein, wenn es darum geht, neue Wähler*innen zu gewinnen und wenn eine Partei versucht, alle Bevölkerungsgruppen gleichzeitig abzuholen, sagt Professor Brettschneider. Dies sei aber per se kein Nachteil, da genau diese Fokussierung auf ein Thema das ist, was manche Wähler*innen suchen.
Viel Herzblut – wenig Belohnung
Insgesamt ist die Lokalpolitik etwas, das vor allem in den Kleinparteien viel Aufwand und Zeit kostet – und dafür bekommen sie zumindest monetär nicht viel zurück. Die Chance, mitzuwirken und etwas verändern zu können, ist die Belohnung. Für Michael Badura zumindest ist die Entscheidung, in Dortmund dabei zu bleiben, sehr leicht: „Ich mag die Stadt einfach.“
Beitragsbild: pixabay.com/Peggy_Marco