
Bücher prägen, wie Kinder die Welt sehen – aber die Buchwelt entspricht nicht der Realität. Der Kinderbuchmarkt in Deutschland bildet die kulturelle Vielfalt hierzulande kaum ab. Das hat einige Konsequenzen.
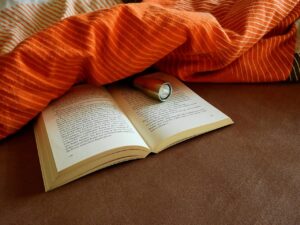
Stell dir vor, du bist wieder sechs Jahre alt. Du brauchst ein neues Buch, weil du das letzte gestern heimlich nachts mit der Taschenlampe unter der Decke zu Ende gelesen hast. Es war so spannend, dass du gar nicht mit dem Lesen aufhören konntest. Das Buch war anders als alles, was du bisher gelesen hast. Es hat sich angefühlt, als hättest du es schon immer gebraucht.
Du willst noch mehr Bücher, die so sind, aber deine Eltern kennen keine. Sie sagen, das macht nichts, weil ihr direkt nach der Schule in die Schulbibliothek oder zum Bücherladen gehen und nachschauen werdet. Aber dort schütteln auch Schulbibliothekar*in und Buchverkäufer*in den Kopf. „Nein, solche Bücher haben wir hier nicht. Du kannst es höchstens da hinten in der Abteilung mit den ganzen diversen Büchern versuchen.“ Du verstehst gar nicht, was das heißen soll, ein diverses Buch? Und wieso ist das Buch nicht da, wo deine anderen Bücher sind?
Ich sehe was, was du nicht siehst
Vielleicht hast du so etwas in der Art tatsächlich als Kind erlebt. Vielleicht hast du sogar noch nie ein Buch über ein Kind gelesen, das nicht so war wie du, oder das so war wie du. Bildet der deutsche Kinderbuchmarkt die Realität der kulturellen Vielfalt im Land wirklich ab oder bleibt da noch so einiges unsichtbar?
Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland lag laut dem Statistischen Bundesamt 2020 bei 35 Prozent. Der deutsche Kinderbuchmarkt bildet die kulturelle Vielfalt des Landes nicht ab. Das zeigt eine Studie des Goethe Instituts zur Diversität in deutschen Kinderbuch-Bestsellern im Jahr 2020. Seitdem ist der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland auf 43 Prozent gestiegen. Viele Akteur*innen des deutschen Buchmarkts sind sich einig, dass sich die kulturelle Diversität des Landes auch heute dort immer noch nicht widerspiegelt.
Denken lernen durch Lesen

„Man meint es oft nicht, aber Bücher sind weiterhin ein sehr bedeutsames Medium im Alltag und beim Aufwachsen von Kindern, gerade von Jüngeren. Sie prägen ihr Weltbild“, erklärt Prof. Dr. Erika Schulze.
Sie ist Professorin für Kindheit und Jugendsoziologie an der Hochschule Bielefeld. Ob als fester Bestandteil vor dem Schlafen, zum Einführen neuer Themen, zur Vermittlung von Sachwissen oder zur Sprachbildung, Kinder seien ständig von Büchern umgeben. Und das auch weiterhin, trotz aller neuen Medien und der Digitalisierung. Egal, ob sie selber lesen oder ihnen vorgelesen werde: Bücher würden Kinder auf Ausflüge in neue und aufregende Welten mitnehmen, Trost spenden und bei der Bewältigung emotionaler Herausforderungen unterstützen können.
„Was in Büchern vermittelt wird, hat auf Kinder einen wichtigen Einfluss“, sagt die Professorin. „Kinder lernen relativ früh, dass es Unterscheidungen gibt und ob diese mit Hierarchien verknüpft sind. Das bezieht sich zum Beispiel auf geschlechtsbezogene Unterschiede oder das Aussehen, wie beispielsweise die Hautfarbe von Personen.“ Das bedeutet laut Schulze, dass Kinder lernen, mit gesellschaftlich unterschiedlichen Bewertungen von Positionen zu agieren, selbst wenn sie das ganze System noch nicht verstehen. Sie würden dann zum Beispiel sagen: „Du darfst nicht in die Bauecke, weil du ein Mädchen bist.“ So würden sie lernen, in welcher Position sie „zu sein haben“. Für die nicht privilegierte Position bedeute das emotionalen Schmerz.
Meine, deine oder keine Kultur?
„Wenn die Held*innen in Büchern mehrheitlich weiß und zudem auch männlich sind, wird Kindern beigebracht, dass das die bedeutsamen Protagonist*innen sind“, sagt Schulze. Auch Spaß am Lesen und Lernen habe mit Identifikation zu tun. Es sei deswegen sehr wichtig, dass alle Kinder sich in den Büchern, die sie lesen, wiederfinden – auch auf der Bildebene. Sie würden sich dadurch in ihrer Identität bestärkt fühlen und sehen, dass es gut und richtig ist, wie sie sind und wie sie leben.
Held*innen wie Connie, mit der Kinder Hürden und das Aufregende im Alltag erleben, Die drei Fragezeichen und die Fünf Freunde, die Kinder auf spannende Abenteuer und geheimnisvolle Fälle mitnehmen: Sie alle sind bekannte und beliebte Charaktere in viel verkauften Büchern. Laut Schulze braucht es aber zusätzlich diverse Geschichten und Held*innen. Damit Kinder sich wiederfinden können, ist es laut der Wissenschaftlerin wichtig, beispielsweise kulturelle Hintergründe, Hautfarben, Geschlechter, Familienmodelle, sexuelle Orientierung, sowie Behinderungen und Beeinträchtigungen zu berücksichtigen.
Es brauche die Vielfalt in den Büchern auch, um die Empathie von Kindern zu fördern, die auf diese Weise anderen Kulturen und Lebensweisen begegnen können. „Es hat etwas mit Demokratiebildung zu tun, zu lernen, dass Deutschsein und Zugehörigkeit breiter sind, als leider in vielen Fällen diskutiert wird. Wir sollten unsere Kinder stark machen für Demokratie, die zumindest in der Theorie verbunden mit Gleichheit und Rechten für alle ist“, betont die Wissenschaftlerin. Es müsse Bildungsauftrag sein, Kinder zu stärken und sie auf die Realität vorzubereiten. Auch der deutsche Buchmarkt müsse diese Möglichkeit für Kinder bieten.
Reale Fantasiewelten

Doch wie sieht der deutsche Buchmarkt das? Christine Lederer ist Verlagsleitung bei Karibu. Sie ist den ganzen Tag von Büchern umgeben. Auch in ihrem Büro steht ein riesiges Buchregal. „Es ist wichtig und spannend für Kinder, ihren Blick über diese deutsche Nachbarschaftsgesellschaft hinaus zu öffnen“, sagt sie. Karibu ist Teil der Edel-Verlagsgruppe und hat sich laut Lederer als Ziel gesetzt, die Vielfalt unserer Gesellschaft und die heutige Welt abzubilden. „Wenn ein Buch nicht die Realität, in der wir leben, abbildet, dann ist das einschränkend. Ich glaube, dass Kinder, die das Gefühl haben, dass die Welt ein offener und großer Ort ist, sich auch als Erwachsene hoffentlich so verhalten, dass sie das wertschätzen können.“
Auch viele Institutionen sprechen sich dafür aus, dass es kulturelle Vielfalt in Kinderbüchern braucht. Die Amadeu Antonio Stiftung schreibt zum Beispiel in einem Online-Beitrag zum Thema „Diversität in Kinderbüchern“ aus dem Frühjahr 2022, dass Kinder Identifikationsmöglichkeiten bräuchten, um selbstbewusste Erwachsene zu werden. Stereotype könnten hierdurch abgebaut und Respekt und eigene Perspektiven so geschaffen werden.
Die Suche nach Vielfalt

Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund lag laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2023 bei 43 Prozent. Im deutschen Kinderbuchmarkt spiegele sich diese kulturelle Vielfalt nicht wider, sagt Regina Feldmann. Es sehe im Gegenteil düster aus. Feldmann ist Kinderbuchautorin und arbeitet ehrenamtlich bei AfroKids Germany, einem Blog, der Kinder of Color in Kinderbüchern in den Vordergrund stellt.
Dieser Berufsweg war eigentlich gar nicht ihr Plan. Warum es trotzdem dazu kam, erklärt die Autorin so: „2014 bekam ich mein erstes Kind und habe deswegen nach Kinderbüchern gesucht. Es war aber überhaupt nicht viel an diverser Kinderliteratur zu finden.“ Aus diesem Grund habe sie angefangen, Bücher aus dem englischsprachigen Bereich zu bestellen und selbst zu übersetzen. Sie habe ihren Kindern außerdem eigene Geschichten erzählt, die diese immer wieder hören wollten. Das habe die Autorin dazu bewegt, die Geschichten aufzuschreiben. „Weil weiterhin wenig an diverser Kinderliteratur zu finden und das Buch schon geschrieben war, dachte ich mir: Warum nicht einen Verlag finden?“
Buchmarkt im Wandel?
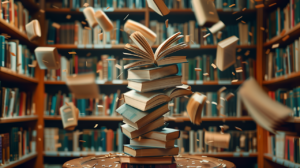
Ab 2020 habe sich mit der Black Lives Matter Bewegung einiges in diesem Bereich getan. Literaturagenturen und Verlage hätten erkannt, dass es mehr Diversität in den Büchern brauche und dass die Gesellschaft das auch fordere. Feldmann betont, dass seit ihrer Kindheit in den 90ern ein großer Wandel stattgefunden habe. Die Bücher, hätten damals oft nur weiße Protagonist*innen gehabt. Wenn People of Color vorkamen, dann seien es stereotypische und rassistische Darstellungen, sowohl in Bild als auch in Sprache gewesen. Heute werde sowas eher geahndet, auch von der Gesellschaft, da auch die Aufklärung größer sei.
Zuletzt ist diese Entwicklung laut der Autorin aber wieder rückläufig. Das zeige sich in den Verlagsvorschauen für das Frühjahr 2025. In ihnen kämen kaum noch Schwarze Protagonist*innen vor – und auch keine Diversität an sich. „Own Voices Stimmen sind so gut wie gar nicht mehr vorhanden, obwohl sie sowieso schon sehr rar waren“, ergänzt Feldmann. „Es ist schade, dass wir so weit gekommen sind, mehr Diversität in den Büchern hatten und es jetzt stagniert oder sogar zurückgeht.“
Auch Professorin Erika Schulze erkennt Probleme in der aktuellen Situation: „Was ich so von Kinderbuchautor*innen of Color oder welchen, die selber eine Migrationsgeschichte haben, lese: Ich denke, sie kämpfen ziemlich, um sich in den Verlagen zu platzieren“. Insbesondere in größeren Bücherläden tue sich bei den ausgestellten Büchern nur sehr wenig. „Es gibt ganz viele tolle diverse Bücher, aber man muss sich wirklich auf die Suche machen.“
Immer nur die Nebenrolle
Laut der Studie des Goethe-Instituts zur Diversität in deutschen Kinder-Bestsellern treten Black Asian Minority Ethnic-Figuren (BAME-Figuren) ausschließlich nur als Neben- oder Randfigur auf – und dies insbesondere in Zusammenhang mit der Rassismusproblematik oder um kulturelle Unterschiede zu verkörpern. Im Zeitraum von Mai 2019 bis April 2020 gab es laut der Studie in 44 Prozent der untersuchten 18 deutschen Kinderbuchbestsellern keine einzige BAME-Figur. In den anderen 56 Prozent seien sie ausschließlich Rand- oder Nebenfiguren.
Die Studie ergab, dass in den untersuchten Büchern auf jegliche Form von kulturellen Bezügen und auf Benennungen von Unterschieden verzichtet wurde. Die Migrationsgeschichten, Herkunftsländer und die Kultur der BAME-Charaktere scheinen für die Protagonist*innen selbst keine Bedeutung zu spielen. Diese Darstellung erschafft laut der Studie das Bild, dass ein Zusammenleben nur funktioniere, wenn alle gleich beziehungsweise Minderheiten an Mehrheiten angepasst seien.
Erzähl mir mal die Wahrheit!

Autorin Regina Feldmann wünscht sich Veränderung. „Alle Kinder verdienen es, sich gespiegelt und authentisch abgebildet zu sehen. Das heißt, dass sie nicht aus einer Fremdperspektive in Rollen, wie die der Hilfebedürftigen oder die der Nebencharaktere gedrängt werden, denen man auf die Sprünge helfen muss.“ Oft sei zu beobachten, dass nicht kultursensibel übersetzt werde. Das sei aber zum einen essenziell für die Menschen, die sich mit den Kulturen auskennen. Zum anderen sei auch für diejenigen, die keine Berührungspunkte mit unterschiedlichen Kulturen haben, eine authentische Abbildung wichtig. Sonst könne dies Vorurteile und Klischees fördern.
„Wenn ich über etwas lese, dann möchte ich, dass es authentisch und wahrheitsgemäß ist. Geschichten aus einer Fremdperspektive zu imaginieren, hat Grenzen. Es sind die kleinen Details, die jemand selbst erlebt und gefühlt haben muss, die Bücher brauchen, um zu begeistern“, sagt die Autorin.
„Fake sein“ bringt uns allen nichts
Seit ein paar Jahren besteht laut Feldmann das Problem, dass Diversität als Trend verstanden werde und es ein falsches Bild darüber gebe, wann diese wirklich vorhanden sei. „Viele meinen, dass ein Buch plötzlich divers ist, wenn ein paar Gimmicks auftauchen. Wenn man zum Beispiel einen Rollstuhl malt oder ein Kind braun anmalt – meistens noch ‘light skinned‘. Das ist aber eher ‚Diversity washing‘“.
Deswegen sei wichtig, dass „Own Voices“ Stimmen gezeigt und in den Vordergrund gerückt werden. Wenn man dies nicht tue, würden marginalisierte Menschen noch weiter an den Rand gedrückt. „Obwohl der ‚Diversity Trend‘ für die Buchbranche lange sehr lukrativ war, wurden vielen Schwarzen und Autor*innen of Color Zugänge verwehrt“, sagt Feldmann.
Verlagsleitung Christine Lederer findet: „Man tut sich keinen Gefallen, wenn man versucht, ein Programm abzuarbeiten und sagt, man braucht jetzt diese und jene Art von Kind. Das nimmt dann ja keiner ernst, wenn es aufgesetzt wirkt, und es soll sich ja echt anfühlen“, betont sie.
Die Extra-Kiste
In vielen Einrichtungen, die Bücher verkaufen oder verleihen, zeige sich beim Angebot laut Professorin Erika Schulze wenig Heterogenität. Für die Bücher, die es in Buchhandlungen und Bibliotheken schaffen, gebe es dann „so eine problematische Sortierung“. „Da gibt es eine extra Kiste, die zum Beispiel, Toleranz und Zusammenleben‘ heißt“, sagt sie. „So bleiben die Bücher, die da reingesteckt werden, trotzdem etwas Besonderes.“ Diese Kategorisierung sorge wieder für eine Abgrenzung.
Money Money Money
„Bücher sind extrem teuer. Da stellt sich die Frage, wer sich die leisten kann. Außerdem frage ich mich immer: Wie viel hat das mit Verlagspolitik zu tun und damit, dass sich die Verlage denken, wir müssen ja auch Geld verdienen? Und dass deswegen dann eher ein weißes Publikum mit einem hohen Einkommen aus der bürgerlichen Mittelschicht bedient wird.“, möchte Professorin Erika Schulze wissen.

Laut Verlagsleitung Christine Lederer versuchen viele Verlage, ihre Bücher für unterschiedliche Lesevermögen anzubieten. „Ich glaube, den Kostenaspekt haben Verlage schon im Blick. Aber wir müssen auch Geld verdienen. Damit orientieren wir uns natürlich an den Menschen, die Bücher kaufen.“ Eigene Studien darüber, wie die Leserschaft tatsächlich aussieht, führe der Verlag nicht durch. Er berücksichtige jedoch unter anderem die Sinus-Milieu-Studie und Umfragen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Für Autorin Regina Feldmann ist klar: „Menschen mit Migrationshintergrund werden oft nicht als Zielgruppe wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie oft ich oder andere Kolleg*innen schon gehört haben: ‚Eure Leute kaufen keine Bücher und besuchen keine Lesungen.‘ Ich glaube, es ist eine verpasste Chance, dass auf dem gesamten Buchmarkt, der sehr weiß und oft auch sehr männlich dominiert ist, Entscheider*innen marginalisierte Menschen als Zielgruppe nicht mitdenken oder als nicht wichtig erachten.“
Und jetzt?
Dass es Veränderung braucht, darin sind sich Erika Schulze, Christine Lederer und Regina Feldmann einig. Für die Zukunft und mögliche Lösungen haben sie noch jeweils einen Appell:

Wissenschaftlerin Erika Schulze sagt: „Wir müssen uns alle dafür stark machen, dass es eine größere Breite an diversen Büchern gibt, und an mehr Sichtbarkeit für diese Bücher arbeiten.“ Es sei eine wichtige Grundlage für die Demokratie und für eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sind. „Kinderbücher sind hierfür ein wichtiger Bestandteil, den wir nicht unterschätzen sollten“, ergänzt Schulze.
Auch Verlagsleiterin Christine Lederer hält Veränderungen für dringend notwendig. „Gerade in der Zeit, in der wir leben, ist es wichtig, dass wir versuchen, eine Normalität zu schaffen“, sagt Lederer. Alle Kinder sollten sich in Büchern repräsentiert sehen. „Wir tun uns aber keinen Gefallen, wenn wir versuchen, etwas zu erzwingen. Die Bücher müssen vor allem authentisch sein.“
Autorin Regina Feldmann setzt auf Zusammenarbeit: „Menschen dürfen sich nicht heraushalten und sagen: Es ist jetzt so, was sollen wir denn machen? Lasst uns darauf achten, wer die Bücher geschrieben hat, wer sie übersetzt hat, wer sie illustriert hat und gezielt die Buchschaffenden unterstützen, die bisher viel zu wenig Repräsentation genossen haben.“ Dazu gehöre zum Beispiel, Own-Voices-Bücher zu kaufen und Black-Owned Verlage und Buchhandlungen zu unterstützen. Feldmann betont: „Wenn ich von Unterstützung rede, meine ich keine Almosen, denn das sind großartige Bücher! Lasst uns einander einfach die Türen aufhalten.“
Beitragsbild: Adobe Stock/Rawpixel.com




