
Die Pfarrei St. Gertrud in Essen hat eine über 750-jährige Geschichte. Nun wurde 2025 ihre Kirche geschlossen. Wie ist es, wenn eine Gemeinde jenen Ort verliert, in dem Jahrhunderte lang gebetet, gefeiert und geweint wurde?

Einen Tag vor dem letzten Sonntagsgottesdienst in der Kirche Sankt Gertrud öffnet diese ihre Türen für alle, die Abschied nehmen möchten. Wenige Menschen schlendern durch die Kirche oder sitzen auf den Bänken und betrachten das riesige Wandmosaik hinter dem Altar. Einige nehmen neugierig ausgelegte Fotos hoch, auf denen ehemalige Pastore, Gemeindereferenten und Messdiener zu sehen sind. Andere – machen Fotos mit einer gemieteten Selfie-Box. Ein Pastor lacht, als sein Foto zu früh geschossen wird. Hinter ihm steht eine große Holzfigur der Heiligen Gertrud. Um ihre Füße liegen Blumen. Auf dem ausgedruckten Foto steht: „Abschied von St. Gertrud – 21.06.2025“. Zarte grüne Blätterranken zieren den Rand des Bildes.
In der ersten Kirchenbank, direkt hinter der Selfie-Box, sitzt eine ältere Frau mit kurzen weißen Haaren und signalrotem T-Shirt. Sie erzählt, dass sie gebürtige Dortmunderin ist und dort lange Zeit Teil einer Gemeinde war – bis die Kirche schließen musste. Nun teilt dieses Schicksal auch St. Gertrud. „Das ist ein bisschen, als würde man einem das Zuhause wegnehmen.“ In ihrer Stimme schwingt ein trauriger Unterton.
„Entscheidend ist eigentlich nicht das Gebäude“
Inmitten des Geschehens steht Pfarrer Dr. Michael Dörnemann und redet mit verschiedenen Menschen. Eine ältere Frau mit Rollator reicht ihm ein Bild. „Das ist 1923“, sagt sie. Beide blicken mit einem kleinen Lächeln auf das Foto, bis die Mienen wieder ernster werden. Dörnemann verschwindet öfter aus dem Blickfeld – ist mal bei der Selfie-Box, mal am anderen Ende der Kirche, mal bei den ehrenamtlich Engagierten. Diese verteilen an dem heißen Samstag in der Vorhalle Getränke und Snacks an bedürftige Menschen.
Es sei ein eigenartiges Gefühl gewesen, in dieser Kirche Pfarrer zu werden und zu wissen, dass sie in ein paar Jahren schließen muss, erzählt Dörnemann. „Mir hilft der Gedanke, dass für die Christinnen und Christen, über die Jahrhunderte hinweg eigentlich nie das Gebäude das entscheidende ist.“ Er erwähnt das Neue Testament. Dort steht, dass die Gemeinde die „lebendigen Steine“ einer Kirche seien.
„Natürlich, emotional, verbinden die Menschen was mit Gebäuden. Das eigene Zuhause hat ja auch eine große Bedeutung. Das ist für viele Menschen auch die Kirche, in der sie groß geworden sind. Aber entscheidend ist eigentlich nicht das Gebäude, sondern der lebendige Mensch, der den Glauben lebt.“
Schon in der Frühzeit des Christentums – also vor gut 1700 Jahren – haben die Gläubigen bewusst keine griechischen oder römischen Tempel übernommen. Stattdessen orientierten sie sich an den römischen Basiliken, öffentlichen Versammlungsräumen. „Weil für sie nicht der Tempelbau an sich entscheidend war, sondern die Gemeinschaft der Menschen, die sich dort versammelte“, erklärt Michael Dörnemann. Wenn diese Gemeinschaft nicht mehr zusammenkommt, verliere auch der Raum seinen heiligen Charakter. So erging es auch der Kirche St. Gertrud in Essen.
Sankt Gertrud bleibt nicht leer

Für den Pfarrer und seine Gertruder Gemeinde gibt es einen Trost: das Gebäude bleibt. Michael Dörnemann ist froh, dass die Kirche bald eine tolle Weiterverwendung findet. Ab Oktober zieht die Hochschule für bildende Künste ein.
Der Verkauf an einen Investor musste gut überlegt werden, wie Dörnemann erklärt. Zuerst hätte sich die Gemeinde überlegt, was gut zu der Sankt Gertrud Kirche passen würde. „Wofür steht sie denn? Ein Raum für Bildung und Gemeinschaft. Herzensgemeinschaft, Menschenfreundlichkeit. Wenn die Hochschule hier einzieht, dann werden zumindest diese Ideale weitergelebt. Viele andere Dinge hätten hier nicht gepasst. Es war gut, dass wir uns Zeit gelassen und auf den richtigen Investor gewartet haben.“
Die Zeit vor den Investoren
Es gibt viele Gründe, warum eine Kirche ihre Tore für die Gläubigen schließen muss. Im Fall der Sankt Gertrud kamen immer weniger Menschen. Für Michael Dörnemann hängt das mit einem Strukturwandel zusammen. Immer weniger seien offiziell gläubig und der Glauben habe, laut Dörnemann, nicht mehr die Bedeutung wie vor einigen Jahrzehnten. Je weniger Menschen kommen, desto mehr Kirchen müssen also schließen. Für die Gemeinde Sankt Gertrud war eine Messe zu Heiligabend der Schlüsselmoment. „An Heiligabend waren von unserer alten Gemeinde nur noch 9 Leute da – daneben aber rund 70, die wir noch nie gesehen hatten und die wohl wegen der günstigen Uhrzeit gekommen sind. Da wurde uns klar: Die Kirche ist zu groß für unsere kleine Gemeinde. Wir mussten der Realität ins Auge sehen.“
Kirchen verschwinden, weil der Glaube (an die Kirche) schwindet
Dass der Glaube schwindet, hat mehrere Ursachen. Eine davon dürfte das schwindende Vertrauen in die Kirche sein. In den letzten Jahren machen immer wieder Skandale, besonders der katholischen Kirche, Schlagzeilen. Für Pfarrer Dörnemann ist klar, dass die Kirche Offenheit zeigen und für die Menschen da sein muss. Es fehlt an Mitarbeitenden– ehrenamtlichen wie festangestellten. Wenige würden noch Priester oder Gemeindereferentin werden. Früher hätten die Gemeindemitglieder sich gegenseitig geholfen und die Kirche nach außen vertreten. Heute sehe das anders aus. Die Gesellschaft sei individualisierter. Dörnemann betont, dass das kein moralisches Urteil sei.
„Ich kann nicht plötzlich fordern, dass es in Kirchen noch genauso sein soll wie früher, wenn wir nicht mehr die Leute haben, die für dieses Gesicht einstehen. Und ich glaube eine Wende kann es nur geben, wenn Menschen sich in Kirchen engagieren und dadurch auch eine positive Erfahrung mit Kirche vermitteln. Dann kann etwas Neues wachsen.“
Mit Engagement in der Kirche meint Dörnemann besonders die caritative Arbeit, also Menschen zu helfen, egal welche Herkunft oder Religion sie haben. Ihnen zuzuhören, sie wirklich zu sehen und auf Augenhöhe zu begegnen. Auch wenn die Umbrüche der Kirche vorerst vereinzelt und klein sind, so lässt sich der Pfarrer nicht von seiner positiven Einstellung abbringen. „Kleine Aufbrüche, die sich verstetigen, können eine große Wirkung erzielen. Ich bin da zuversichtlich.“
Kirchen als „Vierte Orte“
Peter Köddermann, Projektleitung Zukunft-Kirchen-Räume von Baukultur NRW, hat bereits viele Gemeinden begleitet, die ihre Kirche aufgeben mussten. Für ihn sind verlassene Kirchen eine Chance, neue Räume für die Gesellschaft zu gewinnen. Räume, die Treffpunkte der Gemeinschaft sind und die Platz für Selbstreflexion bieten. Das liegt Köddermann sehr am Herzen. Genau da kommen die Kirchen ins Spiel. „Kirchen haben etwas Luminöses, etwas Unbeschreibliches für uns alle. Für mich auch. Wenn ich in eine Kirche gehe, sehe ich nicht nur einen Raum, der für Gemeinschaft errichtet ist, sondern auch einen Raum, in dem ich mich selbst reflektieren oder in mich gehen kann.“
Für den Projektleiter ist es eine wichtige Aufgabe, Kirchengemeinden bei dem Transformationsprozess zu helfen und zu begleiten. Jeder lebe heutzutage eher unter sich, würde weniger über den eigenen Freundeskreis hinaus gehen. Auch die Trennung zu anderen Kulturen hat sich laut Köddermann eher verfestigt als aufgelöst. Daher seien diese besonderen Orte eine neue Chance für Orte der Begegnung.
„Die Frage ist, ob man’s zulassen will“
Oft würden Kirchen allerdings wie normale Immobilien behandelt werden. Man sehe nur das Gebäude, nicht dessen Funktion. Durch Entscheidungen, die nur auf Wirtschaftlichkeit beruhen, könne die Gesellschaft diese besonderen Orte verlieren. Damit sie in ihrem Wesenskern erhalten bleiben können, müssen die langjährigen Transformationsprozesse gut organisiert und im besten Fall begleitet werden.
Dass viele Gemeinden allein gelassen werden, erlebt Peter Köddermann aus erster Hand: „Ich erlebe häufig, dass Gemeindemitglieder gerne mit so einer Kirche umgehen würden, aber sie haben das Gefühl, dass sie an der Komplexität einer solchen Aufgabe scheitern. Für eine ehrenamtlich arbeitende Person ist es nicht einfach, sich an ein Projekt heranzuwagen, dass zwischen sechs und zehn Jahre andauert. So wird die Kirche schnell als ein Problem der Gemeinde gesehen und nicht als ein Chancen-Raum. Trotzdem: dieser Wechsel funktioniert, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen und Hilfe anbieten.“
Fahrradshop im Altarraum
Dass der Wandel funktioniert, zeigt ein Beispiel, an das der Projektleiter gerne denkt. Begeistert erzählt Peter Köddermann von einer evangelischen Kirche in Krefeld. Nach ihrer Schließung betreibt nun jemand einen Fahrradshop darin. Der Besitzer des Ladens räume für besondere Feste gern alles weg, damit die Kirche wieder als Raum für Gemeinschaft genutzt werden könne.
Nun heißt es erstmal: Abschied nehmen

In der letzten Sonntagsmesse der Sankt Gertrud begleitet Bischof Franz Joseph Overbeck die Messe. Er trägt ein prächtiges grünes Gewand. Die Farbe steht für das Leben, das Wachstum und die Hoffnung. Eine klare Nachricht an die Gemeinde. Neben Dutzenden Besuchenden und Gertrudern, nehmen auch Nonnen, Mönche, Thomas Kufen, der Oberbürgermeister von Essen und Pfarrer Michael Dörnemann Abschied. Zehn lange weiße Kerzen sind entzündet und schmücken den Altar. Die Zahl steht für Veränderungen und Wendepunkte im Leben, auch für das Einläuten eines neuen Kapitels. Ende und Anfang gehen oft Hand in Hand.
Bereits 20 Minuten vor Beginn der Messe sind alle Bänke gefüllt und viele Besuchende stehen in der letzten Reihe an der Wand. Fotografen laufen wie in einer geheimen Choreografie umher. Zwischen den Bänken ist ein Meer aus bunten Kleidern, Blusen und Hemden. Zwei Frauen lächeln und nicken sich zu, als sie aneinander vorbeigehen. Wenige Minuten später betritt ein Mönch mit weißer Kutte die Kirche und legt sich mit seinem ganzen Körper auf den kalten Steinboden. All dies steht in einem starken Kontrast zu den üblichen Messen, die nahezu leer waren.
„Hoffnung ist mehr als Zuversicht“

Als die Messe beginnt, begrüßt der Pfarrer seine Gemeinde und richtet einige Worte an sie. Kurz darauf ist die gesamte Kirche erfüllt mit Gesang und getränkt mit Weihrauch. Einige singen mit gesenkten Köpfen. Andere lassen ihren Blick wandern und betrachten die bunten Glasfenster oder die vielen Menschen um sie herum. Als der Bischof spricht, blicken alle gespannt zum Altar.
Er erzählt über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dass die Sankt Gertrud Kirche neugebaut werden musste. Er redet über Zeiten von Wandel, die Hoffnung und Flexibilität von den Menschen verlangten. Alles stehe im Wandel, aber der würde nur gelingen, wenn es Menschen gäbe, die Hoffnung hätten, ergänzt der Bischof. „Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Hoffnung nicht ein Sehnen ist, nach dem was war. Hoffnung heißt immer wieder anfangen.“
Das Leben nach dem Lebewohl
Eine Woche nach der letzten Messe gibt es bereits eine Sonntagsmesse an einem neuen Ort. Auch wenn St. Johann offiziell die neue Pfarrkirche ist, feiern die Gertruder nun öfter in dem Dom Gottesdienst. Da ist die kleine Gemeinde nicht allein, denn schon eine andere Gemeinde besucht dort regelmäßig die Messe. Trotz des Umzuges hält die Gemeinde zusammen. Die kleine Gruppe an Gertrudern trifft sich weiterhin vor und nach den Gottesdiensten, um über „Gott und die Welt“ zu reden. Der Abschied von ihrem Zuhause ist Gesprächsthema. Als Sprachrohr der Gemeinde berichtet Michael Dörnemann, dass die Gertruder die Abschiedsmesse sehr würdig fanden. In den Dom wurden einige Gegenstände aus der alten Kirche überführt, wie das Altar Kreuz. Das Gertruder Evangeliar, eine Bibel mit einem kunstvollen Einband, wurde auch bei der ersten Messe an dem neuen Ort verwendet. „Daraufhin gab es sehr positive Reaktionen,“ erzählt Dörnemann.
Welchen letzten Satz er seiner Kirche mitgeben möchte? „Es ist schwer einem Gebäude etwas zu sagen.“ Nach einem Moment der Stille sagt der Pfarrer dann aber doch: „Ich konnte sowohl beim Sterben meiner Mutter, wie auch beim Sterben meines Vaters dabei sein. Da kann man nur sagen: Danke für alles. Das kann ich natürlich einem Gebäude auch sagen. Danke für alles, was ich hier erleben durfte.“

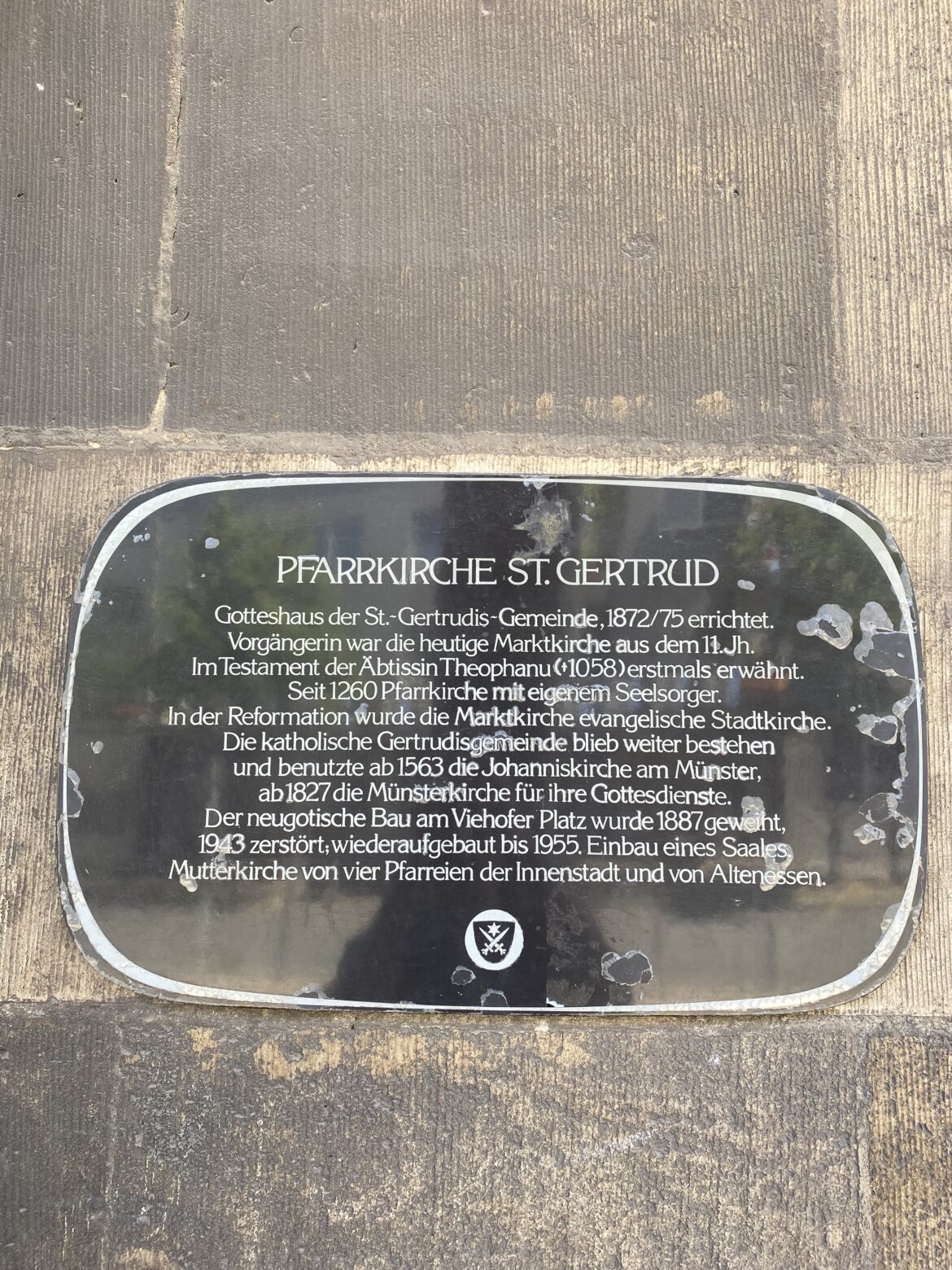










Fotos: Marie-Christin Korth





