
Trigger-Warnung: Dieser Artikel thematisiert mentale Erkrankungen (insbesondere Depressionen) und dazugehörige Symptome.
Depressionen. Eine Krankheit, mit der unsere Autorin nun bereits seit etwa acht Jahren lebt. In ihrem Text spricht sie darüber, warum sie die Depressionen bis dato immer geheim gehalten hat – und warum sie genau das nun nicht mehr tun möchte.

Würde ich meine Freund*innen, Arbeitskolleg*innen oder frühere Klassenkamerad*innen fragen, an welche unserer gemeinsamen Momente aus den vergangenen Jahren sie sich gern zurückerinnern, so würden sie bestimmt unsere Klassenfahrten nach Italien oder Frankreich nennen, die unzähligen Konzerte oder die langen Filmabende.
Auch ich erinnere mich gerne an diese Momente zurück – mit dabei sind aber stets auch Erinnerungen an schwierige Zeiten, die mit diesen schönen Erinnerungen einhergehen. Zeiten, in denen da dieses merkwürdige, betäubende Gefühl in meiner Brust war, weshalb ich mich so leer gefühlt habe, mich zurückziehen und von den Menschen um mich herum abkapseln musste. Zeiten, in denen meine Depressionen meinen Alltag bestimmt haben.
So! Jetzt ist es raus. Ich habe Depressionen.
Mittlerweile seit circa acht Jahren. Und während die Krankheit und ihre Symptome in der Vergangenheit immer auch mit schönen Erlebnissen Hand in Hand gegangen sind, bin ich mir sicher, dass sich meine Freund*innen, Arbeitskolleg*innen und früheren Klassenkamerad*innen nicht an meine depressiven Phasen erinnern können. Warum? Weil ich sie stets vor ihnen geheim gehalten habe.
… und damit ist jetzt Schluss!
Eines sollte ich aber noch klarstellen, bevor ich weiterschreibe: Meine Depressionen waren nie ein hundertprozentiges Geheimnis. Meine Familie wusste von Anfang an von meiner Krankheit und stand und steht mir während dieser ganzen Zeit zur Seite. Nur mein restliches soziales Umfeld eben nicht – und das hat oft in einer Not geendet, passende Ausreden zu finden.
14.15 Uhr. Um 15 Uhr wollen wir uns am Bahnhof treffen, meine Freundin und ich. Bis vor ein paar Stunden habe ich mich noch total darauf gefreut. Jetzt sträube ich mich davor, mich fertigzumachen und die Wohnung zu verlassen. Ich kann einfach nicht, möchte mich viel lieber in meinem Bett einigeln und darauf hoffen, dass das Gefühl ganz schnell wieder abnimmt. Ich packe das heute nicht – greife daher nach meinem Handy und tippe: „Hey du, wäre es okay, wenn wir das Treffen verschieben? Ich weiß auch nicht, was los ist, mir geht‘s irgendwie nicht gut im Moment. :-(“
Natürlich wusste ich damals, was los war. Nur aussprechen konnte ich es nicht. Warum genau – das festzumachen, fiel mir damals schwer. Heute kann ich schon viel mehr über meine Beweggründe sagen. Ich habe mich nicht etwa für meine Krankheit geschämt. Das tue ich auch heute nicht.
Vielmehr hatte ich Angst, dass ich „in Watte gepackt“ würde, wenn mein Gegenüber von meinen Depressionen weiß, und Menschen unwohl dabei ist, mit mir zu sprechen. Außerdem sollten vor allem meine liebsten Menschen nicht das Gefühl bekommen, sie hätten Schuld daran, wenn es mir wie aus dem Nichts auf einmal nicht mehr gut geht.
Deshalb habe ich so getan, als wäre alles in Ordnung, habe meine depressiven Symptome wie „Alltags-Wehwehchen“ aussehen lassen. Das will ich aber nicht mehr – und genau deswegen schreibe ich diesen Text.
„Ach, ich bin nur müde.“
Freitagabend, ein Club in meiner Heimat. Die Oberstufen meiner Stadt feiern das bald anstehende Abitur. Erste Etage: Sitzbereich, einige Couches und Tische, ich mittendrin. Eben war noch alles gut, ich war zwischen meinen Freund*innen, habe getanzt und gelacht. Jetzt fühle ich mich wieder taub und leer. Ich ziehe mich zurück, bleibe in der Ecke sitzen – mir ist nicht mehr nach Tanzen. „Du siehst irgendwie richtig traurig aus“, wirft mir ein Typ neben mir an den Kopf. „Ach – ich bin nur müde. Hab‘ letzte Nacht kaum geschlafen.“
Müdigkeit, Kreislaufprobleme, Unterleibsschmerzen, Kopfweh – Beschwerden, die in meinen depressiven Phasen schon oft als Entschuldigung herhalten mussten. Hinterfragt werden sie nämlich quasi nie. Und falls doch, dann ist Müdigkeit schnell mit einem „Hab‘ schlecht geschlafen“ und Unterleibsschmerzen mit der Menstruation erklärt.
Bei Depressionen hingegen war das, so habe ich es zumindest wahrgenommen, immer anders. Dafür gibt es nicht „den einen“ Auslöser, den Grund, den ich nennen könnte, wenn ich gefragt würde, wo die Krankheit bei mir herkommt.
Deshalb habe ich es gelassen. Vielleicht auch, weil es mir damals besser tat, die Depressionen zu verheimlichen, als ständig über sie zu reden. Heute, in Momenten wie jetzt, in denen ich bewusst darüber spreche, wie es mir damals ging und heute geht, merke ich aber, wie sehr es mich befreit und wie gut es sich anfühlt, die Krankheit als einen Teil meines gesamten Alltags zuzulassen – und nicht nur dann, wenn ich alleine bin.
Warum ich das genau jetzt gemerkt habe, weiß ich nicht. Einen Auslöser kann ich nicht festmachen. Das Bedürfnis, darüber zu sprechen, war einfach plötzlich da. Was ich dafür aber umso genauer weiß: Zu den Depressionen zu stehen, fühlt sich großartig an. Damals hätte ich das natürlich nicht wissen können – heute schon. Und genau deswegen schreibe ich diesen Text.
Worüber ich noch nicht spreche
Ich weiß, dass ich ohne meine Familie niemals einen so guten Umgang mit meiner Krankheit gefunden hätte. Ich weiß aber auch, dass der Weg dahin viel Traurigkeit und Schmerz für sie bedeutet hat, weshalb ich hier nicht weiter darauf eingehen, in der Vergangenheit herumwühlen und alte Wunden öffnen möchte.
Was ich sagen kann: Meine Familie ist der Grund, warum ich heute noch hier sitze. Wie dankbar ich bin und wie sehr ich sie liebe, weiß ich kaum in Worte zu fassen. Ich bin mir zum Glück aber sicher, dass sie es auch so wissen.
In meiner eigenen, kleinen Welt
Es gab und gibt neben meiner Familie vieles, was mir geholfen hat, mich gehört zu fühlen und mit der Krankheit besser umzugehen. Zum Beispiel Musik, aus den Kopfhörern oder live bei Konzerten, die es geschafft hat, Worte für Gefühle zu finden, die ich selbst nicht in Worte fassen konnte. Wenn ich diese Worte dann bei Konzerten mitsingen, ja, sogar eher mitschreien konnte, war das befreiend. Natürlich ist das kein Ersatz für ein Gespräch mit Menschen, die mir nah sind, oder auch einem*einer Therapeut*in, aber es half (und hilft mir heute noch) dabei, meine Gefühle rauszulassen, ohne diese erklären zu müssen.

Auch andere Bereiche der Kultur waren eine Art Zufluchtsraum für mich – zum Beispiel Poetry Slams mit Poet*innen, die über ihre eigenen Depressionen in der Öffentlichkeit sprachen und mit denen ich mich oft identifizieren konnte. Und auch mein Kater Felix war immer für mich da. Er hat es immer gespürt, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, und sich dann ganz von alleine an mich gekuschelt.
Ein Video, das mich vor allem in der Phase bestärkt hat, in der ich für mich entschieden habe, meine Krankheit nicht mehr verheimlichen, sondern offen und öffentlich über sie zu sprechen, ist der TED-Talk von Silja Björk aus Reykjavik aus dem Jahr 2014. Unter dem Titel „The Taboo of Depression“ spricht sie darüber, wie sie ihre Depressionen und Angststörung lange Zeit verschwieg. Nun aber appelliert sie dazu, Depressionen und andere psychische Krankheiten nicht mehr als Tabu, sondern als normales Gesprächsthema zu sehen. So, wie es auch ein gebrochenes Bein, Kopfschmerzen oder Müdigkeit sind.
Silja ist eine Inspiration für mich – und so habe ich mich mit ihr per Videochat getroffen, um mit ihr über ihren TED-Talk zu sprechen, unsere Krankheit und mein Vorhaben, offen damit umzugehen.
„Warum passiert mir all das?“

Silja hatte viele Jahre an Depressionen gelitten, bevor sie in ein psychiatrisches Krankenhaus kam, um dort behandelt zu werden. Das war 2013 – also etwa ein Jahr vor ihrem TED-Talk. „Ich habe oft darüber nachgedacht, warum mir das alles passiert. Das war der schlimmste Schmerz, den ich je erlebt hatte.
Und obwohl ich nicht an Gott oder Ähnliches glaube, dachte ich: ‚Es kann doch nicht sein, dass das Universum mich all das durchmachen lässt, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt. – Silja Björk
Und mit dieser ersten Aussage fasste sie alles zusammen, was auch ich mich immer und immer wieder gefragt habe: Warum passiert mir all das?
Silja entschied sich aus diesem Grund dafür, offen über ihre Krankheit zu sprechen. Sie hält beispielsweise Vorträge vor Schulklassen und behandelt so auch mit Kindern das Thema. Auch ich weiß genau, wie wichtig es ist, über mentale Gesundheit zu sprechen, insbesondere, wenn Betroffene das tun. Auch darüber habe ich mit Silja gesprochen: Dass ich mich wie eine Heuchlerin fühle, wenn ich etwa auf meinem eigenen Instagram-Account Posts teile, die betonen, wie wichtig der Diskurs über mentale Gesundheit ist, ich meine eigene aber verschweige.
Dann gestehe ich mir aber ein, dass ich mich früher noch nicht dazu bereit gefühlt habe. Heute ist das anders: Ich möchte meine Plattform nutzen, möchte auf „Warum passiert mir all das?“ mit „Damit ich darüber sprechen und für mich und andere Menschen in einer ähnlichen Situation etwas ändern kann“ antworten. Und genau deswegen schreibe ich diesen Text.
Schritt für Schritt
Die Medikamente, die ich wegen meiner Depressionen nehme, nehme ich immer zur selben Zeit – abends. Manchmal natürlich auch, wenn ich mit Freund*innen Zeit verbringe. „Hast du ein Glas Wasser für mich? Ich muss eine Tablette nehmen.“ – „Na, klar. Was ist das eigentlich?“ – „Ach, nur was gegen Eisenmangel.“
Ich denke, es ist naheliegend, warum ich in der Vergangenheit nie gesagt habe, worum es sich bei den Medikamenten tatsächlich handelt. Eisenmangel ist besonders bei menstruierenden Menschen keine Seltenheit – daher passte die Ausrede und wurde auch nie hinterfragt. Besonders oft haben meine engsten Freund*innen davon mitbekommen. Einer von ihnen ist Rony, mein bester Freund seit circa zehn Jahren.
Eigentlich habe ich mit ihm immer über alles und jede*n sprechen können – nur die Depressionen habe ich auch vor ihm verschwiegen. Bevor ich diesen Text veröffentliche, war es mir wichtig, einigen Menschen selbst von meiner Krankheit zu erzählen, Schritt für Schritt, Person für Person. Als erstes Rony. Und genau das habe ich dann auch getan.
„Hey, ich würde dir gerne was erzählen.“
Rony und ich gucken regelmäßig Filme zusammen, mit den Jahren ist das irgendwie unser Ding geworden. Beim letzten Filmabend habe ich ihn dann gefragt, ob wir vorher eine Runde um den Block laufen könnten. Das haben wir dann auch gemacht – und ich habe ihm von allem erzählt. Natürlich zunächst von meinen Depressionen und warum ich diese vor ihm verborgen habe. Danach noch von allem anderen, was mir im Kopf herumgeschwirrt ist. Und seine Reaktion – die war genauso, wie ich sie mir erhofft hatte:
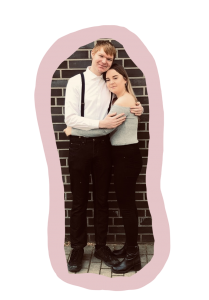
Er hat mich einfach reden lassen, mich dann gedrückt und einige Fragen gestellt. Und danach war wieder alles so wie vorher. Die einzige Ausnahme: Die Erleichterung, die ich auch hier mehr als deutlich gespürt habe und noch immer spüre, wenn ich mich mit Rony wie gewohnt unterhalte. Nichts hat sich anders angefühlt und auch jetzt, ein paar Wochen später, ist noch immer alles beim Alten. Keine Geheimnisse mehr vor ihm zu haben, fühlt sich toll an. Das hat mich noch einmal in meinem Vorhaben bestärkt, von nun an offen mit meiner Krankheit umzugehen.
„Ich bin sehr stolz auf Leslie und finde es absolut stark und beeindruckend, wie sie mit der Krankheit umgeht. Ich bin ihr sehr dankbar für ihr Vertrauen und dafür, dass sie mir davon erzählt hat“, sagte er mir auf meine Frage, wie er sich nun fühlt, nachdem ich ihm von meiner Krankheit erzählt habe. „Ich will ihr immer zur Seite stehen und es wird mir so, denke ich, noch besser möglich sein, sie in Tiefs zu unterstützen, ihr beizustehen und dafür zu sorgen, dass sie sich nie allein fühlt – allein sein wird sie nämlich nie.“
Hier sitze ich also nun, tausende getippte Zeichen später, mit einem Lächeln im Gesicht, möglicherweise einer Träne im Auge aufgrund der Dinge, die mein bester Freund mir im Gespräch gesagt hat, und ein klein wenig Aufregung, wie wohl sonst die Reaktionen auf diesen Text sein werden. Egal, was auch kommt – ich bin unglaublich stolz auf mich, dass ich so viel zugeben und aussprechen (na ja, eher aufschreiben) konnte.
Ich wünsche mir von Herzen, dass es auch andere Menschen gibt, die sich durch meine Worte bestärkt fühlen, auch, wenn sie selbst vielleicht (noch) nicht über ihre eigene Geschichte sprechen möchten. Depressionen sind nichts, wofür man sich schämen muss. Und genau deswegen habe ich diesen Text hier geschrieben.
Beitragsbild: privat




