Teil 2: In der Manege

Als Martin Amedicks Depression ihre Hochphase erreicht hatte, da stand er im Rampenlicht: Woche für Woche vor zehntausenden Zuschauern im Stadion, das einer Manege gleicht, vor einer Vielzahl von Presseteams, den Augen seiner Mitspieler und den Vereinsverantwortlichen seines Arbeitgebers, erst bei Kaiserslautern, dann bei Eintracht Frankfurt.
Sie alle sahen ihn spielen. Die psychischen Probleme allerdings, die ihn massiv beeinträchtigten, sahen sie nicht. Die hätte man ihm nie angemerkt, meint Amedick. Und beschreibt diese Phase als „großes Schauspiel“, das erst endete, als er sich selbst dafür entschied. Eine Manege ist ein künstlicher Ort, einer, an dem der Zuschauer allzu häufig nur das sieht, was er sehen soll oder sehen will.
Im Fußball, so meinte es mal Sportpsychiater Valentin Markser, der Robert Enke ärztlich betreute, sei es so wie in anderen Sportarten auch: „Wir Fans wollen Helden und Rekorde begucken. Es geht darum, sich durchzusetzen, der Sieger zu sein.“ Verlierer wollten die Zuschauer nicht.
Panik vor dem Spiel
Und weil sich Amedick zunächst scheute, von seiner Erkrankung zu berichten, blieb er völlig stumm und mimte den starken Sportler. Dabei war er das Gegenteil. Er wurde panisch, je näher der Anpfiff einer Partie rückte. „Immer wieder lief in meinem Kopf ab: „Du kannst in diesem Zustand keinesfalls spielen’“, erzählt er.
Diese Angst legte sich erst nach Anpfiff. Davor hatte Amedick teilweise nicht ein Wort herausgebracht. „Ich bin in die Kabine gekommen“, sagt er, „wir mussten immer einige Zeit früher da sein. Aber mit den Mitspielern habe ich nicht gesprochen. Ich saß da also beispielsweise beim Mittagessen und habe nichts gesagt, ich war vollkommen isoliert.“
Die Ursachen für seine Erkrankung, das war Ergebnis seiner Therapie, seien allerdings ebenso wie bei Robert Enke nicht im Wesen des Leistungssports zu finden. Andere Stressfaktoren wie der Tod seines Schwiegervaters oder viele außersportliche Verpflichtungen hätten zu einer bipolar affektiven Störung geführt. Er war manisch-depressiv (siehe Infokasten). 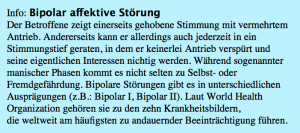
Amedick hatte Bedenken, öffentlich aufzufallen – und ließ sich erst behandeln, als die Belastungen zu groß wurden. Wie Torwart Robert Enke und seine Frau Teresa musste sich auch der Innenverteidiger mit seiner Familie aufwendig um eine externe Behandlung kümmern. Im Verein gab es keinen Ansprechpartner.
Ein vielbeachteter Fußballer zu sein und sich inmitten einer Saison zu befinden, war für Amedick seinerzeit Fluch und Segen zugleich. Einerseits gab ihm der Sport mit seiner klaren Alltagsstruktur den nötigen Halt. Andererseits jedoch gab er ihm das Gefühl, nicht offen und ehrlich mit der Depression umzugehen zu dürfen.
Wenn Amedick auf die Frage antworten soll, ob sich der Umgang mit psychischen Erkrankungen wirklich verbessert habe in den vergangenen Jahren, nennt er in erster Linie einen Aspekt: Heute seien deutlich mehr Hilfsangebote vorhanden. Erkrankte Spitzensportler könnten sich unkompliziert und anonym an ein rund 70-köpfiges Netzwerk von Sportpsychiatern wenden.
Mehr Hilfsangebote
Es sei nun deutlich einfacher, Hilfe zu erhalten, sagt Amedick, „zeitnah“ könnten Termine mit Fachleuten vereinbart werden. Dank der Robert-Enke-Stiftung oder der Netzwerkinitiative „MentalGestärkt“, die solche Angebote entwickelt haben, ist das in der Tat so. Sportler können sich dort melden, beispielsweise per Anruf oder E-Mail – und professionelle Unterstützung erhalten.
Und dennoch gibt es gute Gründe, warum nicht jeder Beobachter ein so positives Zwischenfazit zieht wie beispielsweise Teresa Enke, die als Leiterin der Robert-Enke-Stiftung beherzt für eine Besserung der Lage kämpft und sagt, es hätte sich „einiges verändert“. Zwei Fronten haben sich aufgetan.
Auf der einen Seite stehen diejenigen, die von großen Fortschritten reden und es als Gefahr erachten, diese Fortschritte klein zu machen, weil betroffene Sportler so nie zu einem offenen Umgang mit ihrer psychischen Erkrankung ermuntert würden. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die das Fortschrittsgerede für Schönfärberei halten – und lieber weiter hartnäckig auf die vielen Defizite verweisen.
Viel Kritik am Istzustand
Valentin Markser, ehemals enger Vertrauter der Enkes, gehört zu letzterer Gruppe. „Im System Leistungssport hat sich nichts verändert“, betont er. „Das Thema wird noch immer tabuisiert.“ Und auch der Sportpsychologe Dr. René Paasch meint, dass der Umgang mit psychischen Erkrankungen im Fußball weiterhin stark verbesserungswürdig sei. „Ein Netzwerk zu haben, reicht nicht aus“, betont er. „Sportpsychologen müssen in den Vereinen fest etabliert werden. Und permanent anwesend sein.“

Sportler seien häufig egoistisch, sagt Paasch, der einst beim VfL Bochum angestellt war und aktuell im Einzelcoaching als Sportpsychologe tätig ist. „Sie reden nicht gern über Schwächen. Sie glauben, dass sie alles schon irgendwie alleine hinkriegen. In vielen Fällen stimmt das aber nicht.“
Sportpsychologen, so betont er, sollten deshalb ebenso „zu einer Fußballmannschaft gehören wie Physiotherapeuten oder Mediziner“ – um Probleme frühzeitig erkennen, sie selbst zu behandeln oder den Spieler an eine externe Fachkraft wie einen Psychiater vermitteln zu können. Dafür benötige es allerdings die Möglichkeit, konsequent Teil einer Mannschaft zu sein. Und das ist bei den meisten Klubs nicht im Ansatz gegeben.
Nur sieben Profi-Vereine mit Sportpsychologen
Anlässlich des zehnten Todestages von Robert Enke veröffentlichte die „ARD-Radio-Recherche Sport“ Anfang November 2019 das Ergebnis einer Befragung, die sich an alle 56 Profi-Vereine in den ersten drei deutschen Fußball-Ligen richtete. Mit den Bundesligisten RB Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Düsseldorf und Mainz sowie Zweitligist Nürnberg und Drittligist Braunschweig vermeldeten da nur sieben Profiklubs, einen Sportpsychologen fest angestellt zu haben. Die anderen blieben stumm.
Experten wie Dr. Paasch kommen nach langjähriger Arbeit in der Fußball-Branche zu dem Schluss, dass es in Gänze noch immer „viele unwissende Funktionäre“ gebe, die den Sinn eines Sportpsychologen nicht verstünden.
Der Fußball, in Deutschland stolz als Hochglanzprodukt vermarktet, scheint in diesem Bereich also weiterhin Nachholbedarf zu haben. So müsste doch eigentlich niemand mehr ohne einen gut ausgebildeten Helfer im Hintergrund raus in die Manege gedrückt werden. Viel zu viele werden es aber, wie die Befragung zeigt. Weiterhin gibt es keine Verpflichtung, einen Sportpsychologen im Profi-Bereich zu beschäftigen.
Chancen und Risiken eines Sportpsychologen
Dass es nicht reicht, allein diese Position im Verein zu besetzen, ist klar. Ob ein Spieler den Schritt ginge, sich bei einer privaten Problemsituation an einen Vereinsmitarbeiter zu wenden, müsste doch abgewartet werden. Einen Sportpsychologen in den Kader aufzunehmen, böte allerdings die Chance – und würde vermutlich ebenso dazu verhelfen, dem Thema die angemessene Normalität beizumessen.
Martin Amedick hatte seinerzeit nicht die Möglichkeit, innerhalb des Vereins einen professionellen Gesprächspartner aufzusuchen. Diese Option hätte er sich gewünscht. Und sie könnte auf Strecke gesehen auch den Vereinen große Vorteile bringen. Denn der Sportpsychologe greift nicht nur bei mentalen Problemen ein und kümmert sich um die Erhaltung der Gesundheit des Spielers, er soll gleichzeitig helfen, die Leistung der Profis zu optimieren.
Philipp Laux, der unter anderem bei Bayern München und dem VfB Stuttgart in diesem Feld arbeitete, befasste sich in seiner Arbeit neben dem „mentalen Training“ unter anderem auch mit „der Entwicklung einer Teamkultur“ – und versuchte in enger Absprache mit dem Trainerteam, auf seine Art und Weise zum Gesamterfolg beizutragen. Wobei in der Kommunikation selbstverständlich klare Trennlinien zu ziehen sind.
Vertrauen als hohes Gut
Informationen, die der Spieler mit dem Psychologen teilt, müssen vertraulich bleiben und dürfen nicht an die sportlich Verantwortlichen weitergereicht werden. Eine Leitplanke, die dem Anschein nach nicht alle akzeptieren wollen.
Denn zum einen steht fest, dass mancher Spieler dieser Verschwiegenheitsregel nicht traut und es deshalb eher vermeidet, sich dem Sportpsychologen seines Arbeitgebers anzuvertrauen – aus Furcht, pikante Details könnten dem Trainer oder dem Manager weitergeleitet werden. Und zum anderen ist zu hören, dass manche Vereine die Verschwiegenheitsregel aktiv umgehen wollen und Informationen beim Sportpsychologen einfordern. Es gibt also auch noch Hürden, wenn ein Sportpsychologe angestellt wurde.
„Auch Bochum“, erzählt Dr. Paasch, „hat immer mal wieder gefordert, ich solle etwas erzählen. Dann aber habe ich darauf hingewiesen, welche Profession ich habe und dass ich ganz sicher nichts erzählen werde. Wenn jemand seinen Job ernst nimmt, darf er gar keine Informationen weitergeben.“ Der Sportpsychologe sei dem Spieler verpflichtet – und nicht dem Verein, der sich womöglich gerade in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung befindet und gerne mehr über den Spieler und seine mentale Gesundheit wissen würde.
Höchstleistung trotz psychischer Probleme?
Dass der Zustand mal schwankt oder sich sogar psychische Erkrankungen entwickeln, kann unzählige außersportliche Faktoren haben. Bei Martin Amedick lagen die Ursachen eher fern seines Hauptberufs, und auch Robert Enke erkrankte nicht wegen des Leistungsdrucks oder anderer Stressfaktoren im Fußball. Der ehemalige Nationaltorhüter war sogar äußerst stressresistent, zeigte noch wenige Tage vor seinem Tod eine Leistung ohne Makel.
Danny Rose, englischer Nationalspieler, machte 2018 vor der Weltmeisterschaft öffentlich, dass er an Depressionen leide – und spielte danach ein überzeugendes Turnier. Allgemein sei es ein Irrglaube, dass nur kerngesunde Sportler in der Lage wären, Spitzenleistungen zu zeigen. Er verschwindet erst langsam, ist sich Psychiater Markser sicher: „Das hat sich bei vielen eingebrannt.“
Neben den außersportlichen, individuellen Stressfaktoren jedoch kommen viele innersportliche hinzu, die die mentale Gesundheit belasten können. Dr. Paasch nennt zuerst den „unglaublichen Ergebnisdruck“. Sportler könnten „nicht dauerhaft funktionieren und deshalb nicht dauerhaft gewinnen. Im Sport aber geht es natürlich um Ergebnisse. Dieser Druck macht vielen Spielern zu schaffen.“ Zumal im Fußball, der zum eigenen Wirtschaftszweig erwachsen ist, mit immensen Geldsummen hantiert wird – und die Belastung dadurch weiter steigt.
Scheu vor der Öffentlichkeit
Das zweite elementare Problem, das Dr. Paasch nennt, ist „die Persönlichkeitsstruktur der Sportler“. Die Spieler, häufig von klein auf an den Profi-Bereich herangeführt, „definieren sich oftmals nur über Erfolge, Ergebnisse – wenn die ausbleiben, dann bricht eine ganz wichtige Stütze weg.“
Viele Sportler hätten kein „allzu großes Selbstbewusstsein“, sagt Dr. Paasch. „Die sind neben dem Platz im Grunde ganz kleine Jungs.“ Anschließend erzählt der Sportpsychologe von einem seiner Patienten, der „sich auf der Ersatzbank sitzend mal in die Hose gemacht hat. Das hat niemand mitbekommen.“ Bleibt der Erfolg aus, sei sehr wohl die Gefahr vorhanden, dass eine Erkrankung entstehen kann.
Schmähungen online wie offline
Und ist sie dann ausgebrochen, ist die Scheu offenbar groß, offen damit umzugehen. Erfahrungsberichte von Sportlern wie Amedick oder der Fall Enke bestätigen das. Verantwortlich dafür sei auch die hochemotionale Fankultur. Dass jemand seine Depression verheimlicht und eine Behandlung verweigert, weil er fürchtet, nach einem Outing von den Fans als Schwächling beschimpft oder von den Medien als wenig belastbar eingestuft zu werden, wurde immer wieder öffentlich. Enke ist nur das prominenteste Beispiel. Wer will schon ein „weiches Ziel“ sein?
Die Fußballszene sei weiterhin kein sonderlich empathischer Ort, sagen manche. Andere behaupten gar, die dort herrschende Empathie hätte abgenommen. „Es ist viel schlimmer geworden“, bekräftigt beispielsweise Sportpsychologe Dr. Paasch. „Wir leben in einer Welt, in der sich jeder über Social Media anonym äußern darf. Was geschrieben wird, beschäftigt die Spieler natürlich. Sie beschäftigen sich extrem damit. Und leider gibt es viele unzufriedene Menschen, die Sätze schreiben, die richtig weh tun.“ Im realen Leben werden diese Schmähungen weiterhin lauthals geschrien.
Eine neue Trainergeneration wächst heran
Immerhin: In den vergangenen Jahren ist zu beobachten, dass etwas mehr Nachdenklichkeit, mehr Reflexion vorhanden ist. Zumindest bei manchen Akteuren. Inzwischen sprach beispielsweise der Weltmeister Per Mertesacker öffentlich über seine Versagensangst, Amedick traute sich, seine Geschichte zu erzählen.
Und hatten viele Fußballtrainer früher wenig Ahnung und wenig Interesse an solchen Themen, scheint eine neue Generation Fußballlehrer heranzuwachsen, die mehr und mehr ein Bewusstsein dafür entwickelt.
Ein Deutscher, der bis vor kurzem noch in der Premier League arbeitete und zuvor im Juniorenbereich tätig war, sagt: „Es steht außer Frage, dass das Thema mentale Gesundheit oberste Priorität haben sollte. Man muss die Antennen ausfahren und als Trainer Hilfe zulassen.“ Der Mensch müsse schließlich „über allem stehen. Er ist kein Roboter. Das sollte spätestens der Fall Robert Enke allen eindrücklich gezeigt haben.“




