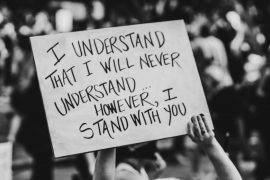Kreuz und quer geht es durch den Wald, immer weiter runter ins Tal. Plötzlich hält Andre Rensing an. Blätter rascheln. Er steht ganz ruhig, den Oberkörper zum Abhang nach links gewandt. Von hinten sieht man nicht, ob seine Augen offen oder geschlossen sind. Vorher hat Andre erzählt, dass er sich auf der Jagd am stärksten auf sein Gehör verlässt. Augen seien trügerisch – im Halbdunkel des Waldes könne irgendwann alles aussehen wie ein mögliches Ziel. Leise hebt er das Gewehr, eine Hand unterhalb als Stütze, die andere berührt den Abzug.
Kreuz und quer geht es durch den Wald, immer weiter runter ins Tal. Plötzlich hält Andre Rensing an. Blätter rascheln. Er steht ganz ruhig, den Oberkörper zum Abhang nach links gewandt. Von hinten sieht man nicht, ob seine Augen offen oder geschlossen sind. Vorher hat Andre erzählt, dass er sich auf der Jagd am stärksten auf sein Gehör verlässt. Augen seien trügerisch – im Halbdunkel des Waldes könne irgendwann alles aussehen wie ein mögliches Ziel. Leise hebt er das Gewehr, eine Hand unterhalb als Stütze, die andere berührt den Abzug.
Er schaut durch das Zielfernrohr. So verharrt er eine Weile. Die Stille ist ohrenbetäubend laut. Dann brummt ein Flugzeug weiter weg. Der Moment ist vorbei. Andre hängt das Gewehr wieder über die Schulter, läuft ein paar Meter. Plötzlich springt direkt neben ihm ein Bock hoch, zum Greifen nahe. Seine Intuition hat ihn nicht getäuscht, er hatte das Tier nur weiter weg vermutet. Er ärgert sich, aber nur kurz. Immerhin hat er ein Tier gesehen. Das ist genug für einen Tag.
Fast jedes Wochenende geht Andre im Wittlicher Wald bei Trier jagen. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, in Trier studiert er im achten Semester Jura. Wenn er redet, blitzt manchmal ein neon-grünes Piercing in seinem Mund auf, eine kleine Kugel. Er trägt eine kurze Jogginghose und ein weites T-Shirt. Sein Jagdoutfit. In Deutschland hatten 2017 etwa 384.000 Menschen einen Jagdschein; die Durchschnittsjägerin ist 51, der Durchschnittsjäger 57 Jahre alt. Das zeigt eine Statistik des Deutschen Jagdverbands.
Seine Freunde wollten ihn schon bekehren
Von Andres Freundinnen und Freunden in der Heimat ist er der einzige, der jagt. Manchmal nimmt er sie mit, um ihnen zu zeigen, wie das Jagen aus seiner Sicht wirklich ist. Viele seiner Freundinnen und Freunde hätten keine Vorstellung davon. Andre sagt, dass viele seiner vegetarischen und veganen Kommilitoninnen und Kommilitonen ein Problem mit dem Tod der Tiere hätten.
Deswegen hätten sie ihn anfangs „bekehren“ wollen, dass das, was er macht, schlecht sei. „Der Tod gehört aber zum Leben dazu. Mich beschäftigt eher, was die Tiere für ein Leben führen.“ Wenn er Fleisch esse, habe er ein größeres Bewusstsein dafür. Seine Freundinnen und Freunde hätten diese Sichtweise mittlerweile akzeptiert. Dass er jemanden zum Jagen mitnimmt, sei trotzdem nur vier, fünf Mal vorgekommen. „Ich will dann meine innere Ruhe finden.“ Es gehe ihm gar nicht ums Jagen an sich, sondern um die Natur. Darum, dass ihm draußen im Wald „keiner auf den Senkel geht“.
Das Jagen verbindet die Familie
Am Morgen vor der Jagd rollt Andres Auto auf die Auffahrt zum Jagdhaus. Dort verbringt seine Familie seit Jahren ihre Wochenenden. Zwei Geländewagen stehen auf dem großen Grundstück. An der Häuserwand hängen mehrere Geweihe. Im Haus gibt’s noch mehr davon, auf einem Kaminsims darunter stehen schwarze Raben aus Metall. Vater Wilhelm, Mutter Rosemarie, Bruder Dominik – alle jagen. Mit acht Jahren hat Andres Vater ihn das erste Mal mitgenommen. Mit 16 hat er den Jagdschein gemacht, er nennt es das „grüne Abitur“. „Das Jagen macht meine Familie aus, das bringt die zusammen“, sagt der Student. Heute sind auch seine Eltern da. Zu dritt frühstücken sie erst mal in der kleinen Küche. Eine riesige Wurstplatte steht in der Mitte; für die Jagd muss Familie Rensing gestärkt sein. Andre köpft sein Ei als erstes.

Andre „Wir alle essen viel zu viel Fleisch.“
Rosemarie: „In der Woche essen wir doch gar nicht viel Fleisch.“
Andre: „Das meiste ist Aufschnitt.“
Wilhelm: „Ich kann auch Gemüsesuppe essen.“
Rosemarie: „Ja, hatten wir ja letztens erst.“
Der Lachsschinken landet auf dem Brötchen. Das Fleisch, das die Familie am Wochenende isst, sei meistens selbst gejagt. „Im Supermarkt kauft man sowieso nur interessant verpacktes Wasser“, sagt Vater Wilhelm. Das Wild, das sie jagen, lebe im Wald ohne Stress. Es sei frei und esse, was es wolle. Das alles wirkt sich auf den Geschmack aus – davon ist Wilhelm Rensing überzeugt.
Das Tier darf nicht leiden
Die Familie bezeichnet sich selbst als tierlieb. „Als Jäger bist du verpflichtet, den Tieren so wenig Leid wie möglich zuzuführen“, sagt Andre. Die Kugel ist schneller als der Schall – wenn der Jäger gut ist und die richtige Stelle trifft, merke das Tier nicht, dass es stirbt. Schnell und schmerzlos. Auf so etwas werde bei der Grundausbildung zum Jäger streng geachtet, meint Andre.
In dem Jagdgebiet bei Trier ist sein Vater der Hauptpächter. Das heißt unter anderem, dass er die Verantwortung gegenüber dem Förster trägt. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird rausgeschmissen. Das sei auch schon mal vorgekommen; Andre persönlich hatte zwei dieser „schwarzen Schafe“ in seinem Umfeld, erzählt er. Die, die einfach auf alles „draufballern“, ohne Rücksicht auf das Tier. Den Kontakt habe er schnell abgebrochen. „Ich finde es gerade beim Thema Jagd, was ja sowieso schon stark polarisiert, sehr traurig. Weil die Leute dann nun mal alle Jäger in einer Schublade stecken“, sagt der Student.


In der Realität sieht das Jagdleben anders aus, als einfach draufloszuschießen: Jedes Jagdrevier hat feste Grundsätze und Vorgaben, zu welchen Jahreszeiten bestimmte Tierarten geschont werden müssen oder welche Art wie oft geschossen werden darf. Für Rehwild erstellt Wilhelm Rensing etwa drei Jahre im Voraus einen „Abschussplan“, der nur gering verfehlt werden darf. Über jedes erschossene Tier wird außerdem penibel Buch geführt. Häufig hätten die Tiere in den Wäldern keine natürlichen Feinde mehr – der Wolf sei so gut wie ausgestorben, meint Andre. Gleichzeitig würden die Winter immer wärmer werden. Rehe und Wildschweine können sich ungestört weiterverbreiten, knabbern die jungen Äste und die Rinde der Bäume ab. Der Wald geht kaputt. Da kommt der Jäger ins Spiel: „Er muss alles wieder ins Gleichgewicht bringen.“
4000 Euro kostet das Gewehr seiner Mutter
Mit einem der beiden Geländewagen geht es raus in den Wald. Das Auto schwankt wie ein Schiff, Äste knallen gegen die Windschutzscheibe. Mitten auf dem Waldweg hält Andre den Geländewagen an. Er öffnet den Kofferraum, darin liegt ein Gewehr. Groß und schwarz, viereinhalb Kilo schwer. Locker hängt er es sich um die Schulter. Er hat es sich von seiner Mutter ausgeliehen; es ist ein bisschen zu klein, sagt er. Aber dafür sei es handlicher und verheddere sich nicht so schnell in den Ästen. 4000 Euro kostet das Gewehr mit Zielfernrohr. Im Waffenschrank der Familie stehen insgesamt zwölf Gewehre, alle in unterschiedlicher Ausführung und Preisklassen. Das letzte Gewehr, das sich der Vater vor zehn Jahren gekauft hat, habe 12.000 Euro gekostet. Andre hat sich noch keine eigene Waffe gekauft; im ganzen Jahr gibt er etwa 300 Euro für sein Hobby aus.
Das Jagen macht meine Familie aus, das bringt die zusammen
Zu Fuß geht es durch den Wald, möglichst leise will sich Andre an das Wild heranpirschen. Vorher muss er die Tiere finden. Nicht umsonst gilt das Pirschen als „Königsdisziplin“ der Jagd. Er sei noch nicht sonderlich geübt darin, sagt er. Normalerweise begleitet er seinen älteren Bruder. Wenn er alleine ist, geht er meistens auf eine Kanzel. Mehr als zehn Meter über der Luft klemmt so eine kleine Holzhütte in einem Baum. Für Außenstehende sei das eher langweilig. Häufig passiere stundenlang gar nichts – bis irgendwann ein Reh vorbeikomme.
Bei der ersten Jagd schoss er einen Rehbock
Als Andre das erste Mal auf ein Tier geschossen hat, war er auf einer Gesellschaftsjagd mit mehreren Personen. Dabei werden die Tiere durch den Wald gejagt und somit der Erfolg, etwas zu schießen, erhöht. Andre schoss einen Rehbock. Wie sich das angefühlt habe? „Schwierig zu beschreiben“, sagt Andre. In dem Moment sei das Adrenalin durch sein Blut gepumpt, er habe an tausende Sachen gleichzeitig gedacht. Seine Hände hätten gezittert. Als alles vorbei war, sei er schlagartig ruhig gewesen. Er habe sich direkt eine Zigarette angezündet. Die Grundregel sei sowieso, dass der Jäger erstmal eine Zigarettenlänge warten solle, bevor er zu dem Tier geht. „Man muss dem Tier Zeit geben, um zu verenden. Dann kann es in Ruhe sterben“, sagt Andre. Wenn das Tier im Sterben liegt und den Jäger sieht, will es instinktiv flüchten und durchlebt zusätzliche Schmerzen.


Beim Pirschen muss Andre auf vieles achten. Vorsichtig setzt er einen Schritt nach dem anderen durch das Dickicht, balanciert zwischen den heruntergefallenen Ästen hindurch. Der Boden knistert laut, das Laub ist trocken. Immer, wenn kleine Grasbüschel zu sehen sind, steigt er auf die geräuschlosen Inseln. Dabei schaut er nach vorne, er darf keine Bewegung übersehen. Plötzlich durchschneidet ein lautes Rascheln die Stille des Waldes, ein Reh schreckt aus dem Schatten eines umgestürzten Baumstammes hervor. Ein gutes Versteck. Panisch galoppiert es davon.
25 Tiere hat Andre getötet
Andre lässt seine Waffe baumeln und schaut dem Tier hinterher. Sobald ein Tier auf der Flucht ist, darf nicht mehr geschossen werden. Jäger-Grundregel. Zu groß die Gefahr, dass man es an einer falschen Stelle trifft und das Tier dann ungeheure Schmerzen leidet, statt sofort zu sterben. Andre ist das mal passiert, als er seinen Jagdschein erst eineinhalb Jahre hatte. Ein typischer Anfängerfehler: Er hat Vorder- und Hinterseite des Tieres vertauscht. Das qualvolle Schreien des Wildschweines sei durch den ganzen Wald geschallt, erzählt er. Deswegen schieße er nicht mehr, wenn er sich nicht sicher ist, ob er trifft. „Das war meine erste und hoffentlich letzte Erfahrung dieser Art.“
Insgesamt 25 Tiere habe Andre erlegt, darunter Wildschweine, Rehe, Füchse und ein paar Enten. In den letzten Jahren seien es immer weniger gewesen. Manchmal, weil er sich den Schuss nicht zutraue, größtenteils aber, weil ihm dieser „Erfolg“ nicht wichtig sei. In seinen Augen zeige es mehr Größe, wenn er sagt, dass er etwas gesehen habe, ohne zu schießen. Am Wochenende übernachtet Andre häufig in einer der Kanzeln. Dann sind da nur er und die Natur. „Da hast du deine Ruhe für dich und kannst einfach abschalten.“
Alle Bilder: Paulina Würminghausen