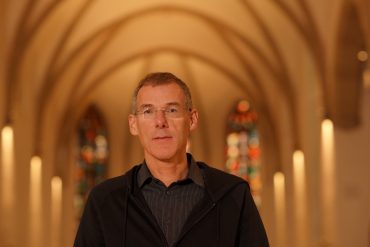Emma Möllenbrock schnürt die Schlaufen um die Langhantel, die vor ihr auf der Matte liegt. Sie rutscht mit den Händen auf der Hantel hin und her, bis sie die richtige Position gefunden hat. 120 Kilogramm liegen da auf der Matte. Das entspricht etwa dem Gewicht von zehn Mountainbikes. Emma stellt ihre Beine breit und geht in die Hocke. Ihre Muskeln sind angespannt – jederzeit bereit, die Langhantel vom Boden zu stemmen. Aber die Hantel bewegt sich nicht. Schafft Emma es doch nicht? Nein, Emma wartet – auf die Musik in ihren Kopfhörern. Dann, endlich, kommt der Drop im Beat. Mit einem kräftigen Ruck stemmt Emma die 120 Kilogramm vom Boden. Drei Sekunden hält sie das Gewicht vor sich, betrachtet ihr schnaufendes Abbild im Spiegel, die Langhantel eng vor der Brust. Dann lässt sie das Gewicht mit einem Plumps wieder fallen.

Emma ist 22 Jahre alt und studiert Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sechs Mal pro Woche geht die Studentin ins Fitnessstudio. Nichts kann sie davon abhalten. Wenn sie eine Vorlesung besuchen müsste, die sie nicht wichtig findet, geht Emma lieber trainieren. Wenn sie den ganzen Tag arbeiten muss, steht sie um 6 Uhr auf, um vorher noch zwei Stunden Gewichte heben zu können. Wenn Emma dann müde ist, trinkt sie ab und zu einen Energy Drink, um wacher und konzentrierter zu sein.
Lennart Keckfort, 22, war mit 13 Jahren zum ersten Mal im Fitnessstudio. Er studiert Sonderpädagogik an der TU Dortmund. Im Corona-Lockdown fängt er an, noch intensiver Sport zu treiben: Er hat Lust, zu trainieren, will besser aussehen, Muskeln aufbauen. Lennart stellt seine Ernährung um und macht täglich Home-Workouts in seinem Schlafzimmer. Auf Social Media sieht er Fitness-Influencer*innen und will sich noch mehr optimieren. Manchmal trainiert er sogar zwei Mal am Tag: erst eine Runde joggen, dann noch ein Workout hinterher. Wenn er keinen Sport machen kann, fühlt Lennart sich schlecht.
Sport tut Körper und Geist gut
„Sport ist gesund“ – so lautet die allgemeine Formel. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen, pro Woche mindestens 150 Minuten Ausdauersport moderater Intensität zu treiben. Das hat einen Grund: Sport hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit und kann Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislaufbeschwerden vorbeugen und behandeln. Wer nur die Hälfte des empfohlenen Umfangs an körperlicher Aktivität erfüllt, hat bereits ein geringeres frühzeitiges Sterberisiko. Und nicht nur das: Untersuchungen belegen, dass Sport positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat. Eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass körperliche Aktivität bei depressiven Patient*innen sogar ähnlich wirksam sein kann wie eine Behandlung mit Medikamenten.
Wer sich bewegt, Sport macht, ins Fitnessstudio geht, tut Körper und Geist also etwas Gutes. Aber ist das wirklich immer so? Vor einem Jahr erlebt die Fitnesswelt einen Schock: Sport-Influencerin Sophia Thiel, die mit ihren Trainingstipps mehr als eine Millionen Follower*innen auf Instagram erreicht, gibt in einem Video öffentlich zu, dass sie an einer Essstörung leide. Thiel berichtet, dass sie jede Kalorie gezählt habe, der Sport zum Zwang geworden sei. Immer habe sie den Druck gespürt, gut auszusehen, immer sei da die Angst gewesen, wieder zuzunehmen.

Dass Sport nicht nur Spaß machen, sondern auch psychischen Druck auslösen kann, erleben nicht bloß Sport-Influencer*innen. Nur zwei Monate hält sich Lennart an sein strenges siebentägiges Trainingsprogramm. Dann wird es ihm zu viel. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass es keinen Spaß mehr macht. Ich habe mich nur noch gequält und das war nicht mehr effektiv“, erklärt er heute. Als in seinem Studium die Klausurenphase beginnt, muss der Sport vorerst zurücktreten. „Ich habe immer weniger Sport gemacht und mich dadurch schlecht gefühlt, was dann auch wieder das Lernen beeinflusst hat. Das war eine Negativspirale“, sagt er.
Trainingsmenge kann entscheidend sein
„Die Dosis macht das Gift“, erklärt Psychologin Marion Sulprizio von der Sporthochschule Köln. Sie ist Geschäftsführerin der Initiative „MentalGestärkt“, die sich mit psychischen Problemen im Leistungssport beschäftigt. „Bis zu einem bestimmten Grad ist das super, dass ich mir Pläne mache, dass ich mir Ziele vor Augen führe, auch im Freizeitsport“, erklärt sie. „Aber, wenn ich zu viel von dieser Sache mache, mich damit unter Druck setze und einschränke, dann geht’s nach hinten los.“
Einen Hinweis darauf, dass weniger Sport manchmal mehr sein kann, gibt auch eine Querschnittsstudie des Lancet Psychiatry Journals, die Daten von 1,2 Millionen Menschen aus den Jahren 2011 bis 2015 ausgewertet hat. Die Studie stellt zwar prinzipiell positive Auswirkungen von Sport auf die psychische Gesundheit fest, beobachtet dabei aber Unterschiede je nachdem, wie viel Sport die Teilnehmenden treiben. Menschen, die am Tag mehr als drei Stunden Sport machen, haben laut der Studie eine schlechtere psychische Verfassung als Menschen, die sich gar nicht betätigen. Sogar mehr als 23 Tage pro Monat Sport zu treiben, soll demnach mit einer schlechteren mentalen Gesundheit in Verbindung stehen. Zu viel Sport zu machen, ist auch aus Sicht der körperlichen Gesundheit nicht effektiv: Denn ab einem bestimmten Pensum bringt mehr Sport nicht unbedingt mehr Vorteile für die Gesundheit.
„Wenn ich sage: Ich kann mich jetzt nicht mit Freunden treffen oder ich darf jetzt kein Bier trinken, weil ich morgen noch meine 20 Kilometer laufen muss, dann ist das ein Problem.“ – Marion Sulprizio, Psychologin
Ab wann genau dieses Pensum erreicht ist, kann die Wissenschaft nicht einheitlich festlegen – und deshalb auch nicht, ob Emma es schon erreicht. Sie trainiert eineinhalb bis zwei Stunden an sechs Tagen in der Woche. Fest steht aber: Emma hat viele ihrer Trainingsziele mittlerweile erreicht, ist zufrieden mit sich und ihrem Körper. Verbesserungsbedarf sieht sie trotzdem: „Man hat immer irgendwas“, sagt sie. „Natürlich hätte ich gerne noch mehr Arsch.“
Ihr „Arsch“ ist überhaupt erst der Grund, warum Emma vor dreieinhalb Jahren mit dem Sport anfängt: Sie wollte endlich einen haben, sagt sie heute. Und: nicht mehr ganz so dünn aussehen. Emma hat damals eine Essstörung, will immer mehr abnehmen. Bis sie Fitness-Influencer*innen auf Instagram sieht und weiß, dass sie so wie sie aussehen möchte – und nicht mehr dünner werden will. „Ich habe irgendwann gecheckt, ich kann mehr essen und besser aussehen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe“, sagt sie.
Die Motivation, aus der wir Sport treiben und ins Fitnessstudio gehen, könne die psychische Gesundheit beeinflussen, sagt Psychologin Marion Sulprizio. Gefährlich sei es zum Beispiel, wenn man einen Sport nur ausübe, um abzunehmen. „Dann habe ich das Ziel von Sport nicht verstanden“, findet sie. Denn: „Gesund ist nicht gleich dünn.“ Gleichzeitig dürfe Sport nicht zum Selbstzweck werden und damit alle anderen Lebensbereiche verdrängen. „Wenn ich sage: Ich kann mich jetzt nicht mit Freunden treffen oder ich darf jetzt kein Bier trinken, weil ich morgen noch meine 20 Kilometer laufen muss, dann ist das ein Problem“, erklärt sie. Denn dann könne sich das Sporttreiben schnell in einen Zwang entwickeln.
Auch Fitness-Apps können – neben positiven Effekten wie einer besseren Motivation – eine ungesunde Beziehung zum Sport fördern. Das zeigt eine Studie der National University of Ireland in Galway. Insbesondere Nutzer*innen, die durch den Sport soziale Anerkennung erfahren wollen, laufen demnach Gefahr, durch Fitness-Apps ein zwanghaftes Verhältnis zum Sport zu entwickeln.
Bis zu 54 Prozent in bestimmten Bevölkerungsgruppen muskelsüchtig
Wenn der Sport ganz und gar im Mittelpunkt steht, ein Zwang und eine regelrechte Abhängigkeit vorherrschen, dann spricht man in der Wissenschaft im Extremfall von Sportsucht – eine Verhaltenssucht, für die es allerdings keine anerkannte Krankheitsdiagnose gibt. Soll durch exzessives Sporttreiben vor allem Muskelmasse aufgebaut werden, so spricht man in Fachkreisen auch teilweise von „Muskelsucht“. Betroffene trainieren im Übermaß, halten sich an strenge Diätpläne und haben eine verzerrte Körperwahrnehmung. Teilweise nehmen sie Proteinpräparate oder missbräuchliche Medikamente ein und vernachlässigen soziale oder anderweitige Verpflichtungen.
Zuverlässige Zahlen, wie viele Menschen an einer Muskelsucht erkrankt sind, gibt es in Deutschland nicht. Die Schätzungen reichen laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von einem Prozent in der Allgemeinbevölkerung bis zu 54 Prozent in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Dazu zählen zum Beispiel Besucher*innen von Fitnessstudios oder Bodybuilder*innen.
Sport aus Zwang: Das kennt Lennart auch. Heute sagt er offen, dass sein tägliches Sporttreiben im Coronalockdown zwanghaft war, er möglicherweise sogar sportsüchtig war. Auch Emma gibt zu, dass sie das Training wegen ihrer Essstörung teilweise extrem ernst genommen hat. „Man schiebt den Zwang woanders hin“, erklärt sie. Trotzdem ist sie froh, dass sie den Sport für sich entdeckt hat. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht mit dem Sport angefangen hätte“, sagt sie.
„Man kann sich selber fragen: Kann ich meinen Trainingsplan unterbrechen und stattdessen ein Stück Torte essen?“ – Marion Sulprizio
Um zu erkennen, ob das eigene Sportverhalten problematisch ist und ob man sogar sportsuchtgefährdet sein könnte, gibt es wissenschaftliche Fragebögen, wie zum Beispiel den „Exercise Addiction Inventory“. Der Fragebogen besteht aus sechs Aussagen, die die Sporttreibenden von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft voll zu“ bewerten müssen.
Es könne aber auch hilfreich sein, sich selbst zu reflektieren, erklärt Marion Sulprizio. „Man kann sich selber fragen: Kann ich das morgen sein lassen? Kann ich meinen Trainingsplan unterbrechen und stattdessen auch mal was Süßes oder ein Stück Torte essen? Wenn ich das schaffe und mich dabei nicht schlecht fühle, ist alles gut.“ Im Ernstfall sollten sich Betroffene Hilfe von außen holen und sich an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin wenden.
Die Gefahr, wieder ein ungesundes, zwanghaftes Verhalten zu entwickeln, sieht Lennart weiterhin. Mittlerweile hat er aber ein besseres Verhältnis zum Sport: Er geht nur noch drei bis fünf Mal pro Woche ins Fitnessstudio und ist viel flexibler, geht immer dann, wenn es gerade passt. „Zurzeit habe ich kein Problem, Sport auch mal ausfallen zu lassen“, sagt er.
Auch Emma weiß heute, dass Sport nicht alles in ihrem Leben ist. Trotzdem ist das Training für sie ein wichtiger Ausgleich. „Ich bekomme da meinen Kopf frei. Das sind die zwei Stunden am Tag, wo ich für mich bin und nicht nachdenken muss“, sagt sie. An ihren Trainingsplan hält sie sich weiterhin strikt: Einen Trainingstag lässt sie nur ausfallen, wenn es einen wirklich guten Grund dafür gibt. Mit Freund*innen geht sie mittlerweile wieder aus, überlegt sich das im Vorhinein aber gut. „Ich frage mich: Wie viel ist mir der Abend wert, dass ich dafür meinen sportlichen Progress stoppe?“
Auf der Suche nach der richtigen Balance
Die perfekte Balance zwischen Sport und anderen Lebensbereichen wie ihrem Studium und ihren Freund*innen sucht Emma noch. Manchmal macht sie sich Gedanken über die Menge ihres Trainings. „Ab und zu kommt schon der Gedanke: Muss das jetzt wirklich sein?“, gibt sie zu. Wenn es beim Training mal überhaupt nicht funktionieren will, bricht sie die Einheit mittlerweile nach 15 bis 20 Minuten ab. Das sei aber praktisch nie der Fall, erzählt sie.
Ob die beiden ihr Training ausfallen lassen und stattdessen ganz viel Sahnetorte essen würden? „Ich bin kein großer Fan von Torten“, sagt Lennart und lacht. „Aber ich würde schon sagen, dass ich das mit gutem Gewissen machen kann.“ „Wahrscheinlich nicht“, gesteht Emma. „Die Kombi ist ein bisschen hart, die Ernährung gehört ja auch dazu.“ Aber auch Emma gönnt sich mal Pausen von ihrem Trainingsprogramm. Zum Beispiel, wenn sie mit ihren Freund*innen in den Urlaub fährt. „Das habe ich ihnen versprochen“, sagt sie.
Beitragsbild: privat