
Im Letzte-Hilfe-Kurs ist Sterben kein Tabuthema. Von Eierlikör bis Patientenverfügung lernen Teilnehmende, wie sie Menschen am Lebensende begleiten können. Was schon junge Erwachsene daraus mitnehmen können.
Frische Blumen, ein Aufsteller mit zwei Herzen und eine Kerze stehen auf dem Boden des Kursraums. Im Kreis herum sitzen zehn Personen. Zwischen ihnen stehen kleine Tischchen, darauf Schalen mit Keksen. Mit im Kreis sitzen Kursleiterin Susanne Eigmüller und ihre Kollegin Heike Kranz. Sie geben eine Rolle Klebeband herum, auf die alle ihren Vornamen schreiben. Es gilt das Kurs-Du. Reih um erzählen die Teilnehmenden, warum sie da sind. Es wird gelacht und geweint, für alle Gefühle ist Platz. Denn die Motivation am Letzte-Hilfe-Kurs in Dortmund teilzunehmen, ist ganz verschieden. Einige kommen aus dem Gesundheitssektor, sind Ärzt*innen oder gehören zum Pflegepersonal in Krankenhäusern. Sterben, Tod und Trauer gehören zu ihrem Berufsalltag dazu. Andere in der Runde haben sich bisher noch nicht intensiv mit den Themen beschäftigt. Sie sind da, weil sie Angehörige verloren haben. Oder Angehörige haben, die bald sterben werden. Keine*r ist jünger als 40 Jahre.

Susanne Eigmüller erzählt, dass in ihren Kursen selten eine Person unter 30 dabei ist. „Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Kurse eher von Erwachsenen wahrgenommen werden“, sagt Christina Motschull. Sie ist die kommissarische Gesamtleiterin der Malteser Hospizdienste in Dortmund und Schwerte und berichtet, dass auch an den Letzte-Hilfe-Kursen der Malteser eher ältere Menschen teilnehmen.
Dabei interessieren sich junge Menschen für Sterben, Tod und Trauer. Eine repräsentative Umfrage der Malteser, dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband und der Uni Graz aus 2020 zeigt: Für die befragten 16- bis 30-Jährigen in Deutschland ist die Auseinandersetzung mit diesen Themen wichtig. Rund 41 Prozent der Befragten gaben an, dass in der Gesellschaft zu wenig darüber gesprochen werde. Gleichzeitig denken 37 Prozent der Befragten sehr viel oder eher viel über Sterben und Tod nach. Besonders Personen, die schon Verlusterfahrungen gemacht haben.
Kleines 1×1 der Sterbebegleitung
Einer der wenigen unter-30-Jährigen, die sich für das Thema interessieren, ist Semih Hasdemir. „Klar hatte ich direkt den Gegensatz zum Erste-Hilfe-Kurs vor Augen.“ Semih ist 28 und studiert an der Uni Wuppertal. Im November 2024 gab es dort das Angebot, einen Letzte-Hilfe-Kurs bei der Evangelischen Studierendengemeinde zu machen. Durch Zufall ist er darauf gestoßen. „Irgendwann saß ich an der Uni, war am Kaffeetrinken. Dann habe ich das Programmheft von der Unikirche gesehen und dachte ich mir: Ja, das ist doch mein Ding.“
Semih ist seit Anfang 2024 muslimischer Notfallbegleiter und hat dafür ein Dutzend Blockveranstaltungen besucht. „Das hat mein allgemeines Interesse für den Tod, für Seelsorge und für Theologie gestärkt“, erzählt er. Bei der Notfallbegleitung liegt der Fokus auf den Angehörigen nach einem Todesfall. Was aber kurz vor dem Tod eines Menschen passiert, das war kaum Teil der Ausbildung. „Nach dem Letzte-Hilfe-Kurs war ich schon etwas erschrocken“, erzählt Semih. Besonders die Beschreibung des Sterbeprozesses ist ihm in Erinnerung geblieben. Außer ihm haben noch zwei andere Studierende am Kurs teilgenommen.
Neben der ersten Hilfe auch letzte Hilfe anzubieten, ist die Idee des Mediziners Georg Bollig, der 2008 erstmals darüber schrieb. Die ersten Letzte-Hilfe-Kurse gab es ab 2014 in Skandinavien und Deutschland. Mittlerweile werden Kurse in 23 Ländern angeboten. Sie richten sich an alle und sind kostenlos. Ein Letzte-Hilfe-Kurs dauert knapp vier Stunden und ist in vier Module aufgeteilt. Es geht darum, das Sterben als einen Teil des Lebens zu verstehen, Wissen über Vorsorge zu vermitteln, aber auch über ganz konkrete Leiden im Sterbeprozess und ihre Linderung zu sprechen. Deswegen wird der Kurs auch kleines 1×1 der Sterbebegleitung genannt. Letzte-Hilfe-Kurse gibt es für Erwachsene, für Menschen im Gesundheitswesen, in leichter Sprache und für Kinder und Jugendliche.
Leben mit Vorsorge im Hintergrund
„Wichtig ist, Dinge vorab zu regeln. Das ist unheimlich erleichternd, wenn der Krankheits- oder Todesfall eintritt“, erklärt Susanne Eigmüller im Kursraum. Vor ihr auf dem Boden liegt ein dicker Stapel Papier mit Mustern von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, aufgeteilt in verschiedenen Mappen. Gegenüber wirft der Beamer flimmernde Buchstaben auf das große Whiteboard: Die fünf W der Vorsorgeplanung. Im Letzte-Hilfe-Kurs in Dortmund geht es nicht nur darum, was Menschen kurz vor ihrem Tod brauchen. Es geht auch um konkrete Vorbereitung für die, die den Sterbeprozess begleiten.

Susanne und Heike gehen die Papierstapel durch: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Vollmachten bei der Bank, bei der Krankenkasse, bei der Rentenversicherung. Und die Notfalldose für den Kühlschrank. Nach der könne man einfach in der Apotheke fragen. Hinein kommen alle Daten, die Retter*innen im Notfall brauchen. Und dann gibt es noch die Wichtig-Mappe. Darin können etwa digitale Passwörter vermerkt werden. „Nur wo die ganzen Unterlagen lagern, damit sie andere auch finden können?“, fragen sich die Teilnehmenden. „Einfach auch mit in den Kühlschrank zur Notfalldose“, meint ein Teilnehmer und grinst. „So nach dem Motto: Wir haben jetzt einen zweiten Kühlschrank, nur für unsere Akten.“ Die beiden Gruppenleiterinnen erklären: Ob im Kühlschrank oder nicht: Wichtig ist, die Dokumente an einem sicheren und für Angehörige bekannten Ort zu lagern.
Vorsorge für den eigenen Tod zu treffen, ist etwas, das auch schon junge Erwachsene betrifft. Mit dem 18. Lebensjahr endet die gesetzliche Vertretung durch die Eltern. Ohne Vollmacht haben dann weder die Eltern noch andere Angehörige das Recht, stellvertretend für die zu handeln, die selbst nicht mehr handlungsfähig sind. Mit der Vollsorgevollmacht kann jede*r eine Vertrauensperson bevollmächtigen, die im Notfall stellvertretend ansprechbar ist. Sie vertritt dann den eigenen Willen, etwa gegenüber Ärzt*innen. Die Patientenverfügung hält den eigenen Willen hinsichtlich der medizinische Behandlung fest.
Laut der repräsentativen Umfrage der Malteser haben 57 Prozent der befragten 16- bis 30-Jährigen noch keine Vorkehrungen für den eigenen Sterbefall getroffen. Jede*r Fünfte hat zwar einen Organspendeausweis, mit weiteren Vorsorgemaßnahmen wie der Patientenverfügung beschäftigen sich aber nur wenige. Christina Motschull plädiert dafür, dass alle eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht in der Schublade haben. Eltern sollten ihren Kindern zum 18. Geburtstag eine Vorsorgevollmacht geben, und sie dazu ermuntern sie für sich selbst auszufüllen. „Wenn die Kinder die Vollmacht dann gar nicht brauchen, dann ist es ja wunderbar. Dann sind sie gesund und ohne Nöte. Aber falls doch mal irgendetwas ist, dann sind alle vorbereitet. Es ist doch mein Leben, was ich vorher mitbestimmen konnte, wenn ich es später nicht mehr kann.“
In der Heimat oder hier?
Auch Semih kommt nach dem Letzte-Hilfe-Kurs mit seinen Eltern ins Gespräch. In ihrem Umfeld hatte es einen Todesfall gegeben. „Ich habe meine Eltern zum ersten Mal im Leben gefragt: Ey Leute, ich werde euch jetzt eine Frage stellen, die für mich wichtig ist als Sohn. Wenn ihr irgendwann sterbt, wo wollt ihr begraben werden? Heimat oder hier?“ Für gebürtige Deutsche sei das kein Thema, meint Semih. Aber in einer Familie mit Migrationsgeschichte sei das anders. „Wenn man da vorher nie drüber geredet hat, und der Tod dann unerwartet kommt. Ja, was tue ich dann? Das will ich als Kind gar nicht entscheiden. Ich will gar nicht, dass die Entscheidung auf meinen Schultern lastet. Deswegen frage ich vorher, und jetzt ist die Sache klar.“
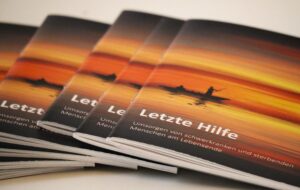
Warum machen nur wenig Jüngere einen Kurs? Und wie können mehr junge Menschen von den Kursen erfahren? Semih glaubt, dass es zwar ein Bedarf vieler Menschen ist, sich mit den Inhalten des Letzte-Hilfe-Kurses zu beschäftigen, sie sich aber diesem Bedarf nicht bewusst sind. Deswegen wünscht er sich mehr Werbung und Aufmerksamkeit. „Leute, tut euch selbst den Gefallen und macht das mal.“
Auch Christina Motschull plädiert für mehr Öffentlichkeitsarbeit. Sie glaubt, dass jüngere Generationen auf anderen Kanälen auf die Kurse aufmerksam gemacht werden müssen. „Dieser typische Stand in der Innenstadt, lockt nicht mehr: Hier sind Flyer und vielleicht noch ein Kugelschreiber.“ Stattdessen würde es sich anbieten, auf Social Media auf die Kurse aufmerksam zu machen. Auch Beiträge im Fernsehen oder Radio tragen dazu bei, dass mehr Menschen vom Angebot erfahren. Susanne Eigmüller ist durch ein Radiofeature auf die Kurse aufmerksam geworden und hat danach die Ausbildung zur Kursleiterin gemacht.
Kaffee, Bier und Eierlikörchen

An einem Ende des Kursraums stehen auf einem Tisch kleine Fläschchen mit Duftölen, Cremetuben, Lotionen und Brausepulver. Auf einer Kiste steht neben Bier, Wein und Malzbier auch eine kleine Flasche Hochprozentiger. Vieles davon wird im Kreis herumgereicht. Zum Ende des Kurses geht es um konkrete Hilfsmaßnahmen. Herumgereicht werden auch kleine Wattetupfer. Die Tupfer können in Flüssigkeit getaucht werden, um die Lippen oder den Mundinnenraum der Sterbenden zu befeuchten. Denn kurz vor dem Tod haben Menschen keinen Schluckreflex mehr. „Deswegen auf keinen Fall zwingen zu trinken“, erklärt Heike. In welche Flüssigkeit die Watte getaucht wird, spielt keine Rolle. Egal ob Kaffee, Bier oder ein Eierlikörchen. „Die meisten wollen eh kein Wasser mehr“, sagt sie und lacht.
An diesen Teil des Kurses erinnert sich auch Semih noch gut. Für ihn war die Info, Sterbenden vor dem Tod keine Flüssigkeit mehr zu geben, erschreckend. „Ich dachte, ich erfahre, dass Sterbende in der Regel das Bedürfnis nach Wasser haben. Und dann in dem Moment absichtlich kein Wasser zu geben, das ist schon irgendwie …“ Diese Infos dann im Sterbemoment präsent zu haben, ist für ihn daher umso wichtiger. Zu wissen, dass Ärzt*innen sich gerade aus gewissen Gründen so verhalten, gebe ihm jetzt Sicherheit. Semih wünscht sich, dass jedem Menschen ein Kurs angeboten wird und alle diesen Kurs dann auch machen. Denn: „Jeder Mensch wird, ob er will oder nicht, irgendwann mit dem Tod konfrontiert sein, ob das dann die Oma, der Opa oder die eigene Eltern oder Freunde sind.“
Fotos: Camilla Pahmeyer




